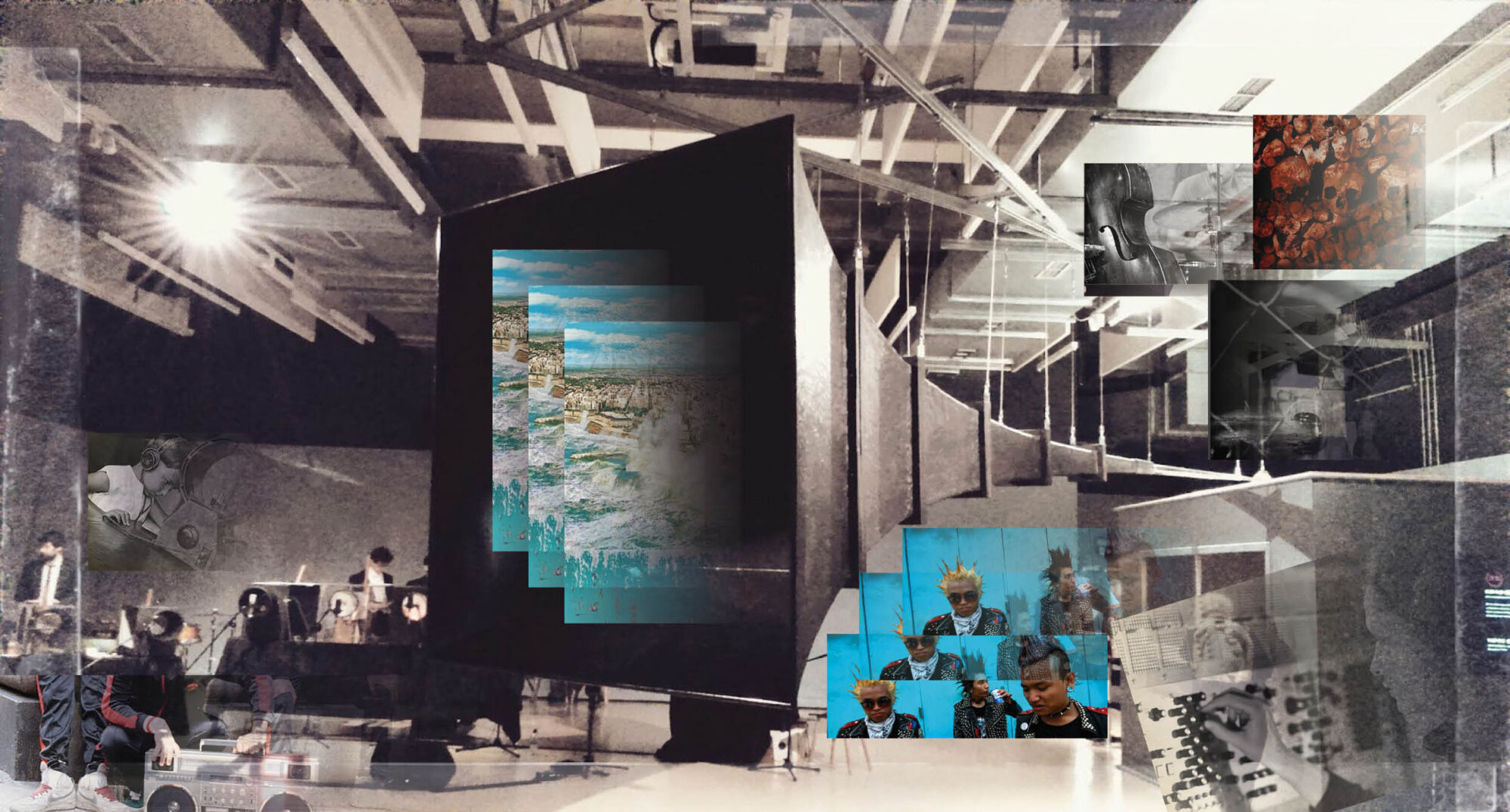In den Dekaden von 1890 bis 1930, vor dem allgemeinen Siegeszug der technischen Massenmedien rund um Radio und Musikfilm, dominierte das Musiktheater die europäische und nordamerikanische Popmusiklandschaft. In Kostümen und Masken porträtierten Performer*innen hier eine ganze Reihe an rassistisch überzeichneten Figuren, die ich in diesem Text mit der postkolonialen Denkfigur The Other/Othering als Inszenierungen von Anderen verstehe. Ich gehe den gesellschaftlichen Machtverhältnissen hinter diesen Inszenierungen auf den englischen, deutschen und US-amerikanischen Musiktheaterbühnen nach und rekonstruiere die kulturellen Hegemonien, Spannungen, Identitäts- und Körperpolitiken, die in solchen Darstellungen „verAnderter“ Subjekte zum Ausdruck kamen.
[Download PDF-Version] | [Abstract in English]
Andere in der populären Musik: Ein Intro
Prozesse der Identitätsbildung sind prekär, konflikthaft und stets politisch. Als kultureller Schauplatz der Artikulation von Identitäten spielt populäre Musik in diese Prozesse hinein, verfestigt und verflüssigt gesellschaftliche Machtverhältnisse, verhandelt Subjektformen und Verkörperungen und tariert damit fortwährend die Grenzen und Hierarchien kultureller Hegemonien aus. Diese Vorgänge haben geschichtliche Dimensionen.
Als Beitrag zu einer historisch geschärften Theorie zur Artikulation von Identitäten in der populären Musik setze ich mich in diesem Text mit den Konstruktionen des Fremden und Exotischen im populären Musiktheater des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts auseinander. Im Mittelpunkt steht dabei die Beobachtung, dass sich in der populären Musik dieses Zeitraums eine ganze Reihe an Identitätszuschreibungen und -politiken rund um solche Konstruktionen des Fremden und Exotischen herausbildeten. Um darauf einen Zugriff zu erhalten, knüpfe ich an postkoloniale Theorie und die dort etablierten Denkfiguren The Other/Othering an. Da im Deutschen hierfür keine einfache Übersetzung existiert, habe ich folgende Lösung gewählt, die der englischsprachigen Verwendung dieser Ausdrücke – insbesondere bei Stuart Hall (1997) – am nächsten kommen soll: Mit Julia Reuters (2002, 20) Übersetzungsvorschlag werde ich im Folgenden von Prozessen der „VerAnderung“ (Othering) sprechen, und wenn es sich um Fälle konkreter Bühnen-Personifikationen handelt, bezeichne ich diese als Inszenierungen von „Anderen“ bzw. von „verAnderten“ Subjekten (Others also im Plural, weil, wie ich zeigen werde, Personifikationen des Fremden oder Exotischen niemals in nur einer einzigen festgeschriebenen Ausprägung auf der Bühne performt werden bzw. wurden).
Die in diesem Text verhandelten Inszenierungen von Anderen fußen auf höchst problematischen Zuschreibungen, mit denen Menschen auf einige wenige, scheinbar essenzielle Eigenschaften reduziert werden (Hall 1997, 257). Oder anders ausgedrückt: Solche „VerAnderungen“ gründen auf rassistischen Stereotypen, die keine Entsprechung zu leibhaftigen Individuen oder ganzen gesellschaftlichen Gruppen haben und diese also nur vorgeblich (re)präsentieren. Musiktheatrale Inszenierungen von Anderen sind also fiktiv, aber mitnichten einfach nur als harmloses Spiel zu werten, da nicht zu bestreiten ist, dass rassistische Bühnen(re)präsentationen reale Machtwirkungen entfalten. Sie bereiten den Nährboden für gesellschaftliche Ausschlüsse und können zur Wurzel von Erniedrigung, Hass und Gewalt werden. Aus diesem Grund lokalisiere ich die Inszenierungen von Anderen hier im Spektrum von kolonialen Fantasien und gesellschaftlichen Abwertungshaltungen, argumentiere aber auch, dass damit gesellschaftskritische Körper- und Identitätspolitiken artikuliert werden konnten. Dies ist, wie ich ausführen werde, in der Doppelstruktur und Ambivalenz der Differenz begründet.
Ich lege meinen Fokus auf das populäre Musiktheater des Zeitraums von 1890 bis 1930. In diesen Jahrzehnten stand das Musiktheater an der Spitze popmusikalischer Unterhaltungskultur, bevor es ab den späten 1920ern vom allgemeinen Siegeszug der technischen Medien Radio, Tonfilm und Schallplatte zurückgedrängt wurde. Politisch waren diese Dekaden durch die Hochphase des westlichen Imperialismus geprägt. Ferner stand dieser Zeitraum im Zeichen globaler Migrationsbewegungen, die in den westlichen Gesellschaften mit Prozessen der Urbanisierung wechselwirkten. Auch wenn es zu allen Zeiten Inszenierungen von Anderen in musikalischen Kontexten gegeben hat – ein Befund, der sich diversen postkolonialen Arbeiten zur populären Musik und auch der Operngeschichte entnehmen lässt (McClary 1992; Radano und Bohlman 2000; Born und Hesmondhalgh 2000; Taylor 2007; Locke 2009; Ismaiel-Wendt 2011) –, möchte ich unterstreichen, dass die hier behandelten Inszenierungen von Anderen und die Konstruktionsmechanismen ihrer Differenz aus konkreten geschichtlichen Hintergründen heraus zu verstehen sind: Sie waren mit distinkten Kulturhegemonien und Gesellschaftsformationen der Jahrzehnte um 1900 verwoben. Um dies herauszuarbeiten, synthetisiere ich in diesem Beitrag diverse historische Forschungsbefunde zum populären Musiktheater der Jahrhundertwende und stelle dadurch einen größer angelegten Bezugsrahmen her. Dabei lege ich meinen Fokus auf England, Deutschland und die USA, da der Vergleich dieser drei geopolitischen Imperialmächte ähnliche Dynamiken zu erkennen gibt.
Die Doppelstruktur und Ambivalenz der Differenz
Ich begreife Konstruktionen von Anderen im Anschluss an poststrukturalistische und insbesondere postkoloniale Kulturtheorie als Produkte gesellschaftlicher Machtverhältnisse (Bhabha 1994; Hall 1996, 1997; Ahmed 2006). Macht wird aus poststrukturalistischer und postkolonialer Perspektive nicht statisch oder deterministisch verstanden, sondern muss in ihrer Wirkung agonal und kontingent – als Effekt von stetigen Aus-/Neuverhandlungen und Interessenskonflikten – gedacht werden. Bestrebungen von privilegierten Interessensgruppen, eine soziale Ordnung zu errichten, münden fortwährend in Versuchen, Bedeutungen festzuschreiben, allerdings bleiben diese jederzeit potenziell wandel- und anfechtbar. Diese Unabschließbarkeit von Bedeutungen erzeugt auch die Doppelstruktur und Ambivalenz, die ich in diesem Text herausarbeite.
Kulturelle Sinnstrukturen, so folge ich Stuart Hall, verhandeln und produzieren Bedeutungen grundsätzlich durch Klassifizierungen, die essenzielle Gegensätze zwischen Dingen, Eigenschaften und Menschen behaupten: „[C]ulture depends on giving things meaning by assigning them to different positions in a classificatory system. The making of ‚difference‘ is thus the making of that symbolic order which we call culture“ (Hall 1997, 236). Diese symbolischen Ordnungen fördern Kartografien aus Unterschieden zutage, in die einzelne Menschen sowohl in Selbst- wie auch in Fremdzuschreibung eingelassen sind. Solche Unterscheidungen fußen auf einem Ausschlussprinzip: Was nicht männlich ist, ist weiblich, was nicht natürlich ist, ist künstlich, was nicht kultiviert ist, ist primitiv, und vice versa. Diese scheinbar unvereinbaren Gegensätze verhalten sich konstitutiv zueinander, da das Diesseitige nur über den Ausschluss eines Jenseitigen entstehen kann. Die postkoloniale Theorie spricht hier von Differenzrelationen: Der positive Pol einer Dichotomie kann immer nur in Bezug auf sein komplementäres Außen, dem negativen Pol, gebildet werden (Hall 1996, 4–5).
In westlichen Gesellschaften werden Subjekte durch solche diskursiv erzeugten Differenzen hervorgebracht, die ihnen kollektiv verbindliche Formen der Identität zuschreiben. Von komplexen Kartografien aus Differenzen ist deshalb zu sprechen, weil sich die Konstruktion von Identität nicht nur auf eine einzige Dichotomie reduzieren lässt. Die Gegensatzpaare einer Dichotomie sind in eine ganze Matrix von binär strukturierten Bedeutungsmarkern eingelassen. So produzieren symbolische Ordnungen etwa Gegensatzpaare wie männlich–weiblich, jung–alt oder Schwarz–weiß. Diese Dichotomien werden miteinander verknüpft, so dass sich deren Pole kreuzen bzw. gegenseitig verstärken (Laclau und Mouffe 2001, 127–34). Im kolonialen Diskurs werden etwa die beiden Dichotomien Kolonisator/Kolonisierte*r und kultiviert/primitiv in gemeinsamer Verschränkung artikuliert, so dass der Kolonisator zum kultivierten Kolonisatoren und die*der Kolonisierte zum*zur primitiven Kolonisierte*n wird.
Weiterhin wird diese Unterscheidung oft mit geschlechtlichen Attribuierungen versehen: Der Kolonisator ist dann nicht nur kultiviert, sondern auch männlich/aktiv, während die Kolonisierte als weiblich/passiv vorgestellt wird. Durch solche Verwebungen von Differenzen entstehen ganze Bedeutungsgeflechte aus voneinander abgrenzbaren Zonen. Auch kommt es auf diese Weise zu Interdependenzen von Differenzen, wie sie seit den Arbeiten von Kimberlé Crenshaw (1991) unter dem Begriff Intersektionalität diskutiert werden: Im weiß-patriarchalen Herrschaftsdiskurs etwa kämpfen Frauen of Color, auf Grund ihres nicht-weißen Status und ihres Geschlechts, also wegen ihrer zweifachen Differenz zur gesellschaftlich dominanten Subjektposition weißer Männlichkeit, gegen eine doppelte Diskriminierung. Differenzen sind hier als „ungleichheitsgenerierende Kategorien“ (Degele und Winkler 2009, 10) oder „Überkreuzungen verschiedener Formen von Diskriminierung“ (Ganz und Hausotter 2020, 10) miteinander verzahnt.
Für Prozesse der „VerAnderung“ bedeutet das nun: Erstens erzeugen diese Kartografien aus Differenzen überhaupt erst konkrete Subjektformen, denn sie machen diese innerhalb einer kulturellen Sinnstruktur intelligibel. Zweitens werden über Differenzrelationen gesellschaftliche Hierarchien errichtet und aufrechterhalten. Dichotomien sind, darauf hat Jacques Derrida (1972) hingewiesen, grundsätzlich machtbeladen und produzieren Privilegien und Ausschlüsse, da immer eine Seite des Pols für vollwertig, akzeptabel oder erstrebenswert erklärt wird, während die andere als mangelhaft, inakzeptabel oder vermeidungswürdig gilt. Damit folgen diese Kartografien der Logik von Hegemonien, d.h. dem Machtanspruch einer privilegierten Gruppe, eine Subjektvorstellung zur alternativlosen Norm zu erklären. Davon abweichende Subjektvorstellungen werden im gleichen Zuge delegitimiert. Wie Andreas Reckwitz (2006) in seiner umfassenden Studie Das hybride Subjekt zeigt, haben westliche Gesellschaften zu unterschiedlichen Zeitabschnitten der Moderne historisch spezifische Vorstellungen eines hegemonialen Subjekts artikuliert, während sie andere Vorstellungen eines Subjekts als minderwertig abgewertet haben. Die hegemoniale Subjektform vereint die positiv konnotierten Attribuierungen in sich, mit Reckwitz gesprochen handelt es sich hier um den Entwurf eines Selbst, während davon abweichende Subjektformen die negativ konnotierten Attribuierungen in sich vereinen und als Entwürfe von Anderen bezeichnet werden können (ebd., 43–50).
Diese Anderen nehmen also all jene Attribuierungen auf, die in diskursiv produzierten Dichotomien für mangelhaft erklärt werden. Sie dienen dem Selbst als Negativfolie, durch die es Vorstellungen erzeugt, welche Eigenschaften es nicht ausprägen sollte, welche Verhaltensweisen tunlichst gemieden werden sollten. Das ist die eine Seite der Medaille, der erste Aspekt der Doppelstruktur der Differenz.
Es gibt eine zweite Seite, denn das Bild der Anderen gleicht einem Vexierbild, das zwischen Aversion und Faszination hin und her kippen kann. Die den Anderen zugeschriebenen negativen Eigenschaften und Verhaltensweisen soll das Selbst nicht inkorporieren, da sie als verdorben und Tabu gelten. Und genau hier liegt eine Faszination für die Anderen begründet, eine, wie Sara Ahmed schreibt: „fantasy of lack, of what is ‚not here,‘ shapes the desire for what is ‚there‘“ (Ahmed 2006, 114). Dies ist die Kippperspektive des Vexierbildes: Indem es sich gegen seine Negativfolie spiegelt und abgrenzt, wird das Selbst trotz der ihm zugesprochenen Privilegien von einem konstitutiven Mangel heimgesucht, da ihm bestimmte Verhaltensweisen untersagt werden. Es projiziert deshalb sein Begehren auf die Anderen, die diese unsittlichen Verhaltensweisen verkörpern dürfen bzw. in der hegemonialen Logik des dichotom verfassten Koordinatensystems sogar geradezu verkörpern müssen. Die Anderen „leben“ gewissermaßen all diejenigen Eigenschaften, die das Selbst von sich abstreift. Blickt das Selbst auf die Anderen, so erblickt es darin immer sein verworfenes Spiegelbild, seine unterdrückten Lüste und nicht-lebbaren Fantasien. So entsteht ein Verhältnis zwischen Selbst und Anderen, das zwischen Attraktion und Bedrohung, Bewunderung und Ekel changiert, wie Homi Bhabha betont (1994, 72). Das Selbst bildet sich in der Doppelstruktur der Differenz, also im gleichzeitigen Abgestoßen- und Angezogen-sein in Bezug auf ein imaginiertes Gegenüber.
Bhabha weist zudem darauf hin, dass dieser grundsätzlich nicht fixierbare Status der Anderen auch dazu führen kann, dass Subjekt(re)präsentationen den eindeutigen Entweder-Oder-Zuordnungen entgleiten und in Zwischenräumen („third spaces“) Platz nehmen, die aus Sicht gesellschaftlicher Herrschaftsstrukturen beunruhigend sind, weil sie nicht mehr von der Logik der Differenzen reguliert werden können (ebd., 111–22). Hier lagert das Potenzial von Widerständigkeit, da die Subjekte des Zwischenraums sich einer eindeutigen Bestimmbarkeit entziehen und somit die hegemonialen Essenzialisierungsbestrebungen grundlegend verwirren können. Wenn Menschen sich diesen Zwischenraum strategisch zu eigen machen, entziehen sie dem kolonialen Diskurs seine Autorität und fordern dessen „rules of recognition“ (ebd., 114) heraus. Damit legen sie Bedeutungsstrukturen frei, die von hegemonialen Repräsentationsmustern nicht benannt werden.
Mit diesen theoretischen Grundgedanken fokussiere ich folgend die Musiktheaterbühne als Produktions- und Aushandlungsraum von Differenzen, da hier wirkmächtige Bilder und Klänge von „Rasse“, Klasse, Geschlecht und anderen Identitätsmarkern erzeugt werden.
Struktur, Formate und Konventionen des populären Musiktheaters, 1890–1930
In den rapide wachsenden Städten des ausgehenden 19. Jahrhunderts entstand in Europa und Nordamerika eine moderne Massenkultur mit boomenden Märkten für kommerzielle Live-Musikunterhaltung (Erenberg 1981, Maase 1997, Morat et al. 2016). Historiker*innen haben aufgearbeitet, wie sich in diesen Jahren eine komplex organisierte Musiktheaterindustrie formierte, die bis in die 1920er Jahre die Speerspitze des professionellen Musikentertainments bildete (Snyder 1989, 26–81; Erdman 2004, 43–81; Becker 2014, 293–394). Die neu entstehenden Angebote richteten sich verstärkt an ethnisch diverse, klassen- und geschlechterübergreifende Zielgruppen.
Ein historisches Novum war etwa der gezielte Einbezug des weiblichen Publikums (Peiss 1986; Becker 2014, 225–228), das in den ersten beiden Dritteln des 19. Jahrhunderts noch von vielen populären Unterhaltungsformen ausgegrenzt wurde, wie z.B. in den amerikanischen Minstrel Shows, in denen Männer auf der Bühne exklusiv für Männer im Publikum performten (Lott 1993). Zur Jahrhundertwende lockten viele Theater nun mit erschwinglichen Eintrittspreisen und brüsteten sich mit einer inklusiven Unterhaltungs-Agenda (Kibler 1999, 23–54). In Anbetracht dieser massenkulturellen Relevanz des Theaters, das hier noch vor dem Durchbruch der technischen Medienindustrie zu einem „Leitmedium“ wurde, argumentiert die Theaterwissenschaftlerin Frederike Gerstner, dass sich die Theaterbühne im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert zu einem zentralen Ort der kulturellen „Zirkulation, Reproduktion und Vervielfältigung von Bildern, Figuren, Szenen und Motiven“ entwickelte (Gerstner 2017, 47). Das Musiktheater war somit fest in der Logik gesellschaftlicher Differenzproduktion verankert und entsprechend mit (Re)Präsentationsmustern von Subjekten verbunden.
Charakteristisch für das damalige populäre Musiktheater war seine Disruptivität. Studien betonen, dass die Unterhaltung hier – im krassen Gegensatz zu den bürgerlichen Opern- und Dramatheaterbühnen – im Modus des Karnevalesken und der Farce stattfand (Jenkins 1992, 28–54; Otte 2006, 258–59). Die damals wichtigsten Musiktheaterformate Vaudeville (USA), Music Hall (UK), Varieté und Posse (D), Burlesque und Musical Comedy (USA, UK) und Revue (USA, UK, D) setzten auf ein schnelllebiges Nummernformat. In Vaudeville, Music Hall und Varieté bestand das Programm ausschließlich aus der Aneinanderreihung von kurzen, meist ungefähr zehn- bis fünfzehnminütigen Einzel-Acts. Auch in den anderen Formaten gab es, wenn überhaupt, nur rudimentär größer angelegte Handlungen (Posse, Burlesque, Musical Comedy) oder Themen (Revue), so dass auch hier die eigentlichen Grundelemente aus Abfolgen von oft völlig zusammenhangslosen Song-, Tanz- und Sketcheinlagen bestanden. So durchlief eine Musiktheatershow typischerweise viele kontrastreiche Settings, was zu Inszenierungen von Exotismen und fremdartigen Orten einlud. Der US-amerikanische Musiktheaterstar William DeWolf Hopper beschrieb dies in seiner Autobiografie von 1927 folgendermaßen:
In musical comedy the story and the score often were as friendly as the North and South of Ireland. Either they ignored each other, or the story was kept leaping madly from the cane fields of Louisiana to Greenland’s icy mountains, to India’s coral strands, and back to a Montana ranch by way of the Bowery, to keep up with the changing costumes of the chorus. The peasants and soldiers, having rollicked a Heidelberg drinking song gave way for a moment to the low comedy of a Cincinnati brewer and the English silly ass in love with the heroine, and were back as cotton pickers cakewalking to the strains of Georgia Camp Meeting. (Hopper und Stout 1927, 56)
In diesen schnelllebigen Nummernformaten dominierte wechselhaftes Maskenspiel: Performer*innen schlüpften in Kostüme und Masken und porträtierten stereotype, groteske und mehr als oft rassistisch überzeichnete Subjekte, die aufgrund dieser Überzeichnung binnen weniger Sekunden vom Publikum zu erkennen waren. Das funktionierte in der Kurzweiligkeit des Musiktheaters besonders gut, wie Henry Jenkins mit Bezug auf irische Stereotype im Vaudeville ausführt:
[A] stock Irishman could be recognized by a collarless shirt, an oversized vest, a pair of loose workman’s pants with a rope belt, a battered hat, all predominantly green; a red wig and a set of red (or sometimes, green) whiskers arranged as a fringe around the face; a propensity for epithets and slang, a sing-song vocal pattern, and a thick brogue. The redundancy with which these accumulated features marked a stage character as a stock Irishman allowed almost instant recognition; spectators could just as immediately draw assumptions about the character’s propensity to drink, his fiery temper, his sentimental nature, and his love of tall tales and loud laughter. (Jenkins 1992, 70–71)
Der Rassismus und Klassismus hinter dieser Stereotypisierung kann gar nicht deutlich genug betont werden. Dennoch fielen derartige Überzeichnungen weitaus vielschichtiger aus, als sie auf den ersten Blick erscheinen. In den Inszenierungen von „verAnderten“ Bühnenfiguren äußerte sich die oben beschriebene Doppelstruktur und Ambivalenz der Differenz. Ich werde im Folgenden zeigen, inwiefern – erstens – diese Inszenierungen koloniale Machtstrukturen und die Kulturhegemonie der weiß-bürgerlichen und patriarchalen Gesellschaft des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts reproduzierten. Zweitens diskutiere ich, inwiefern Performer*innen Formen der „VerAnderung“ performativ einsetzten und umdeuteten, um die Normen ebenjener Gesellschaft herauszufordern.
Koloniale Fantasien
Eine erste Erklärung für die Omnipräsenz rassistischer Stereotype lässt sich mit Blick auf globalpolitische Verhältnisse geben. In den Dekaden um 1900 befand sich der westliche Imperialismus in seiner historischen Hochphase, die der Historiker Eric Hobsbawn als „The Age of Empire“ bezeichnet hat: Weite Teile der Welt unterstanden der direkten Herrschaft oder dem informellen Protektorat einiger weniger Imperialmächte, zu denen neben Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Italien, Japan, Portugal und Spanien auch Großbritannien, Deutschland und die USA gehörten (Hobsbawn 1987, 56–83). In europäischen und nordamerikanischen Diskursen verbreiteten sich (Re)Präsentationsmuster, die Herrschaftsansprüche über die kolonisierten Territorien legitimieren sollten. Die Dekaden rund um die Jahrhundertwende zeitigten eine enorme Anhäufung kolonialer Reiseberichte in anthropologischen Fachzeitschriften (Samson 2005, 68–90). „Entdeckungsfahrten“ kartografierten den Globus gemäß westlicher Überlegenheitsvorstellungen, und auf Weltausstellungen und Jahrmärkten sowie in Zirkussen und Zoos fanden so genannte „Völkerschauen“ statt, um dem „Wissen“ über die Kolonisierten eine öffentlichkeitswirksame Sichtbarkeit zu verleihen (Blanchard et al. 2008).
Edward Saïd (1978) hat solche westlichen (Re)Präsentationsmuster mit dem prominent gewordenen Terminus „Orientalismus“ bezeichnet. Die musiktheatralen Inszenierungen von Anderen sind Teil dieser zeitgenössischen Orientalismus-Diskurse, denn auch die Musiktheaterbühnen der Jahrzehnte um 1900 förderten einen, wie Frederike Gerstner schreibt, „,Bilderatlas‘ ferner Regionen und Kulturen“ zutage (Gerstner 2017, 46). Derart trug das Musiktheater zur Artikulation westlicher Herrschaftsansprüche und zeitgenössischer Rasseideologien bei und hielt koloniale Machtstrukturen aufrecht, die kulturellen Paternalismus, politische Unterdrückung und ökonomische Ausbeutung legitimierten.
Die kolonialen Verstrickungen des Musiktheaters werden beim genaueren Blick auf die Bühnen Englands, Deutschlands und der Vereinigten Staaten deutlich. Hinsichtlich der Stücke des Londoner West End Theaters stellt Tobias Becker (2017, 183–86) fest, dass hier „asiatische“ Motive besonders populär waren. Das britische Empire hegte starke koloniale Interessen auf der arabischen Halbinsel, dem indischen Subkontinent sowie in Südostasien und China und sah im aufstrebenden Japan einen lokalen Kontrahenten seiner eigenen Herrschaftsansprüche.
Bühnenfantasien von orientalisierten Anderen schlugen sich in zahlreichen englischen Operetten und Musical Comedies nieder, darunter die kommerziell überaus erfolgreichen Stücke „The Mikado“(1885, Musik: Arthur Sullivan, Text: William Schwenk Gilbert), „The Geisha“(1896, Musik: Sidney Jones, Text: Harry Greenbank), „San Toy, or The Emporer’s Own“ (1899, Musik: Sidney Jones, Text: Harry Greenbank und Adrian Ross), „A Chinese Honeymoon“(1901, Musik: Howard Talbot und Ivan Caryll, Text: Harry Greenbank), „TheCingalee“(1905, Musik: Lionel Monckton, Text: Adrian Ross und Percy Greenbank) und „Chu Chin Chow“(1916, Musik: Frederic Norton, Text: Oscar Asche). [1] „Arabische“, „indische“ und „ostasiatische“ Figuren wurden in diesen Stücken von weißen Performer*innen in klischeehaften Kostümen, mit geschminkten Gesichtern und Charaktereigenschaften in Szene gesetzt und etwa in „The Mikado“ (Knapp 2005, 250–60) oder „Chu Chin Chow“ (Everett 2007) als blutrünstige Krieger oder intrigante Schurken gezeichnet, die sich in politische Komplotte, Verschwörungen und kriminelle Machenschaften verwickeln und dabei nicht vor Mord und Totschlag zurückschrecken.
Derartige Inszenierungen von orientalisierten Charakteren und Handlungsschauplätzen gehörten zum beständig wiederkehrenden Element im Londoner Musiktheater. Mit der ungewöhnlich langen Spielzeit von fünf Jahren (1916–1920) stellte „Chu Chin Chow“, gemessen an der Anzahl der Aufführungen (2238) und Zuschauer*innen, gar einen historischen Rekord in Großbritannien auf, der erst rund vierzig Jahre später vom Musical „Salad Days“ (1954, Musik: Julian Slade, Text: Dorothy Reynolds und Julian Slade) gebrochen wurde.

Adaptionen dieser englischen Produktionen tourten auch mit Erfolgen in Deutschland. Für das Musiktheater des Deutschen Kaiserreichs, das im Vergleich zum britischen Empire weniger stark als Kolonisator in Asien in Erscheinung trat, beobachtet Becker allerdings, dass das Thema „Asien“ weniger prominent auf den Bühnen vertreten war (Becker 2014, 186). Stattdessen spielte das Kaiserreich seit den 1880er Jahren im so genannten „Wettlauf um Afrika“ eine bedeutende Rolle und tatsächlich konzentrierten sich Inszenierungen kolonialer Fantasien stärker auf diesen Kontext. Das Schema war jedoch zu den englischen Produktionen identisch, insofern dass auch hier die Inszenierungen koloniale Überlegenheitsvorstellungen untermauerten und die Brutalität und ökonomische Ausbeutung des deutschen Imperialismus beschönigten. Oft wurden darüber hinaus männliche Eroberungsfantasien und Sexismen bedient, indem die deutschen Kolonien als feminisiertes Territorium objektiviert wurden, wie beispielsweise in der Jahresrevue des Berliner Metropoltheaters „Das muß man seh’n!“ (Musik: Viktor Hollaender, Text: Julius Freund) von 1907. In einer Szene trat hier ein „Kolonialwarenhändler“ auf, der dem Publikum fünf Frauen namens „Fräulein Südwest-Afrika, Fräulein Ostafrika, Fräulein Kamerun, Fräulein Samoa und Fräulein Kiautschau“ als „biegsame Figuren“ mit „feurigen Augen“ und „tadellosestem Elfenbein“ präsentierte (ebd., 186–87).
In einigen Inszenierungen kam es durchaus zu konkreten Bezügen auf die deutsche Kolonialpolitik. Becker nennt etwa die Metropoltheater-Revue „Der Teufel lacht dazu“ (1906, Musik: Viktor Hollaender, Text: Julius Freund), in der der deutsche Performer Henry Bender in Blackface [2] als Prinz Akwa von Kamerun nach Berlin kommt, „um sich beim Kolonialamt über den deutschen Gouverneur zu beschweren“ (ebd., 188), was tatsächlich einen Bezug zu einer aktuellen politischen Debatte hatte. 1905 hatte eine Vereinigung von politischen Machthabern der Gesellschaften der Duala, darunter der König Akwa von Bonambela und dessen Sohn Mpundu Akwa (der für die Beschwerde mit einer Delegation nach Deutschland reiste), eine Petition gegen die brutale Kolonialpolitik des Gouverneurs Jesko von Puttkamer gestellt und eine Untersuchung durch die Kolonialregierung verlangt. Die Unterzeichner wurden dafür im Gegenzug von Puttkamer in Kamerun angeklagt und zu Zwangsarbeit und Prügelstrafe verurteilt (Kusser 2013, 239–240).
Dieser Fall stieß in der deutschen Öffentlichkeit zwar auf Gehör, wurde aber weitgehend belächelt, so auch in „Der Teufel lacht dazu“. Bei seiner Suche nach dem Kolonialamt trifft Bender in Persona des Prinz Akwa in einer Szene auf den Teufel (gespielt vom österreichischen Schauspieler Josef Giampietro), der sich, gekleidet mit Tropenhut und Reitgerte unterm Arm, auch gerade in Berlin aufhält. In Gegenwart von Akwa singt der Teufel in einem Couplet: „Man bringt verwilderter Nation, Die ohne Zaum und Zügel, Am besten Civilisation, Durch Prügel! Ob andere Methoden man, Auch hier und da erwäge, Es reicht doch schliesslich nicht heran, An Schläge. Gut wirkt ein milder Missionar, Bei Männern, wie bei Frauen, Allein seit je probater war, Das Hauen.“ (zit. n. Becker 2014, 188).
Somit kamen diese politischen Vorkommnisse durchaus zur Sprache, was in den Metropoltheater-Revuen nicht unüblich war, da diese regelmäßig leichte Satiren auf die preußische Obrigkeit und Politik einstreuten und politische Geschehnisse mit ironischen oder bissigen Untertönen kommentierten. Becker hebt an diesem Beispiel hervor, dass die textliche Aneinanderreihung von „Prügel“, „Schlägen“ und „Hauen“ die Brutalität der Kolonialherrschaft geradezu überbetonte und dass sich das Publikum damit nicht nur an den Fall Puttkamer, sondern etwa auch an die blutige Niederschlagung des Herero-Aufstandes in Deutsch-Südwestafrika des Jahres 1904 und die inzwischen als Völkermord eingestuften Folgeereignisse erinnern konnte (ebd., 189).
Die Revue verschwieg das Thema also nicht und gab einen Kommentar darauf, allerdings in einer Konstellation, in der zwei weiße Schauspieler dies auf der Bühne maskenspielerisch zur Darstellung brachten und unter sich verhandelten. Mit Bender bemächtigte sich hier ein weißer Performer in Blackface der Position des Kameruner Prinzen, was das koloniale Schema eben nicht unterwanderte, sondern auf ein Neues reproduzierte. Auch wenn diese Inszenierung also einen Bezug zu einem aktuellen politischen Ereignis hatte und einen kolonialpolitischen Konflikt zum Gegenstand machte, wurde der deutsche Kolonialismus als solcher damit nicht in Frage gestellt. Stattdessen wurde, wie Astrid Kusser in ihrer Analyse dieser Revue schreibt, „Widerstand gegen kolonialen Rassismus in einen anzüglichen Witz [verwandelt], der sich im Publikum in lachendes Wohlgefallen auflösen sollte“ (Kusser 2013, 242).
Eine politische Fundamentalkritik wäre für das Musiktheater der Kaiserzeit auch undenkbar gewesen, da in Preußen eine rigide Zensurpraxis herrschte, die allenfalls leichte Persiflagen auf Politik durchgehen ließ und allzu kritische Stellen aus den Theaterskripten strich (Becker 2014, 60–73). Gerstner stellt heraus, dass die Berliner Theater es generell vermieden, „ernsthaft zu brüskieren oder zu verstimmen“ und so dem streng autoritären Einfluss des „monarchischen Obrigkeitsstaats“ oftmals durch eine Selbstzensur entgegenkamen (Gerstner 2017, 230).
Mit Blick auf die USA, die in den 1890ern durch die Annexion von Hawaii und Puerto Rico sowie die militärische Besetzung von Kuba und den Philippinen als imperialistische Weltmacht in Erscheinung traten, lässt sich beobachten, wie im Musiktheater Songnummern und Motive aufkamen, die ebenjene neuen Kolonien als naturbelassene Inselparadiese darstellten. Insbesondere Hawaii-Songs mit klischeehaften „hula girls“ gehörten bis in die 1920er zum Grundstock des Bühnenrepertoires (Garrett 2008, 165–208). Damit wurde auch Hawaii in Personifikation des „girls“ gemäß einer männlichen Eroberungsfantasie als koloniales Terrain feminisiert, sexualisiert und verniedlicht.
Tatsächlich bestand ein Grundmotiv vieler dieser Hawaii-Songs in der Ankunft eines amerikanischen Touristen, der sich am Strand von Waikiki in eine Hula-Tänzerin verguckt. Manchmal, wie im Song „Oh! How She Could Yacki Hacki Wicki Wacki Woo (That‘s Love in Honolulu)“ (1916, Musik: Albert Von Tilzer, Text: Stanley Murphy, Chas McCarron; siehe Library of Congress. o.D.), war dann sogar weitaus mehr als nur ein Vergucken angedeutet. Da die Geschichte des Kolonialismus nicht nur mit ökonomischer Ausbeutung, politischer und militärischer Unterjochung, sondern auch zutiefst mit sexueller Gewalt verwoben ist (McClintock 1995, 21–31), ist an diesem Songsujet höchst problematisch, dass die hier scheinbar völlig problemlose Verführung eines weißen Mannes durch die Reize und Verlockungen einer „gefügigen“ Frau ebenjene Gewalt verschleiert, um nicht zu sagen schön redet. [3]

Popmusikalische Kolonialfantasien regulierten in den USA aber auch die gesellschaftlichen Hierarchien innerhalb der eigenen Landesgrenzen. Tin Pan Alley-Hits – wie etwa „Hiawatha (A Summer Idyl)“ (1903, Musik: Neil Moret, Text: James J. O’Dea), „Red Wing“ (1907, Musik: F.A. Mills, Text: Thurland Chattaway) oder „Silver Bell“ (1910, Musik: Percy Wenrich, Text: Edward Madden; siehe UC Santa Barbara Library. o.D.b) – zeichneten klischeehafte und romantisierte Porträts von Native Americans, die als sanftmütige Subjekte in Einklang mit einer unberührt gelassenen Natur leben (Troutman 2012, 153–60). Nicht nur täuschte dieses Bildnis einer friedvollen „heilen Welt“ über die Tatsache hinweg, dass den Native Americans mit der Ratifizierung des so genannten „Dawes Act“ von 1887 auferlegt wurde, ihre Siedlungspraxis an die kapitalistische Logik des Privatbesitzes anzupassen, wodurch sie bis zur Aufhebung des Acts im Jahr 1934 ungefähr zwei Drittel ihres Landes verloren und an Souveränität einbüßten (Schultz et al. 2000, 608). Auch äußerte sich im Bild scheinbar glücklich und in harmonischer Einheit mit der „Wildnis“ aufgehobener Native Americans die von der Historikerin Anne McClintock identifizierte koloniale Trope eines „anachronistic space“, einem von Raum und Zeit der modernen Zivilisation entrückten Ort, an dem die Imaginationen des kolonialen Subjekts eingehegt und auf sicherer Distanz gehalten wurden (McClintock 1995, 40–42).
Diese Trope grundierte auch die allgegenwärtige Fantasie der Südstaaten-Plantage, die das US-amerikanische Musiktheater aus der Tradition der Minstrel Shows des 19. Jahrhunderts übernahm und die von den stereotypen Figuren des glücklichen Plantagenarbeiters „Jim Crow“ und der devoten Hausangestellten „Mammy“ bevölkert wurde. In zahlreichen Revuen und Musical Comedies wurden opulente Plantagenszenen aufgeführt, in denen Performer*innen in Blackface ausgelassen über die Bühne tanzten (Gerstner 2017, 91–98; Brown 2008, 24–31). Ein spätes Zeugnis liefert der Vitaphone-Kurzfilm „A Plantation Act“ (Warner Bros, 1926; siehe JeffsGreats 2014) mit Superstar Al Jolson, dessen Songnummern nahtlos an das rassistische Jim Crow-Klischee des armen, zerlumpten und dennoch fröhlich tanzenden und singenden Plantagenarbeiters aus den Südstaaten anknüpften.
Solche Inszenierungen boten einem weißen (und besonders dem männlichen) Publikum Projektionsflächen, um sich einer selbst behaupteten Überlegenheit zu vergewissern, die wiederum half, die Installation von Kolonialregierungen auf Hawaii, Puerto Rico, Kuba und den Philippinen zu rechtfertigen, paternalistische Assimilationspolitik gegenüber den Native Americans zu betreiben, Formen von rassistischer Gewalt und Lynchjustiz zu verharmlosen und die allgemeine Rassentrennung zwischen Schwarzen und Weißen zu legitimieren. Mir sind keine Studien bekannt, die erforscht hätten, ob sich in den Kolonien breitere Widerstandsbewegungen formierten, die diese Repräsentationsmuster des Musiktheaters attackierten. Zumindest im Inland machten von Rassismus betroffene Minderheiten – wie zum Beispiel afro-amerikanische Vereinigungen und Schwarze Zeitungen (Abbott und Seroff 2007, 35–37) – ihre Kritik daran laut. Das war jedoch wenn überhaupt nur von kleinen Erfolgen gekrönt: Zwar wurde die Praxis des Blackface im Laufe der Dekaden zunehmend kritischer gesehen, doch blieben solche rassistischen Performancekonventionen bis in die 1920er für das Musiktheater außerordentlich prägend.
Urbanität und Migration
In einer zweiten Hinsicht standen die Inszenierungen des Musiktheaters in Zusammenhang mit zeitgenössischen Migrationsbewegungen. Im späten 19. Jahrhundert entwickelten sich die europäischen und nordamerikanischen Großstädte durch rapide Urbanisierungsschübe zu kulturellen Schmelztiegeln. Auf innerkontinentalen, transatlantischen und transpazifischen Routen zogen Menschen in der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen und Arbeit in Städte wie Chicago, New York, Berlin und London, die zu gigantischen Ballungszentren heranwuchsen. Wurden die eben beschriebenen kolonialen Imaginationen von Anderen in fern-entrückte und exotische (Natur)Welten platziert, so wurden sie in diesem Kontext als Bewohner*innen der modernen Metropole vorstellig: Die Anderen sind hier urban.
Stereotype Figuren ethnisch markierter Städter*innen multiplizierten sich auf den Bühnen des populären Musiktheaters parallel zum Aufkommen von Diskursen, in denen die zunehmende Einwanderung mit zivilisatorischem Verfall gleichgesetzt wurde. In den Vereinigten Staaten schürte etwa der einflussreiche Frontier-Mythos des Historikers Frederick J. Turner xenophobe und rassistische Ressentiments. In seinem erstmals 1893 erschienenen The Significance of the Frontier in American History (1966) warnte Turner vor einer Übervölkerung und Unterwanderung durch fremde Kultureinflüsse, die nicht mehr organisch absorbiert werden könnten.
Turners Thesen verlautbarten, dass Einwanderung und Besiedelung zu den konstitutiven Säulen amerikanischer Kultur gehörten und zur Bildung einer genuin amerikanischen Mentalität beigetragen hatten: Amerikanische Werte und der amerikanische Charakter hätten sich stets an der Grenze zwischen zivilisierten und unerschlossenen Gebieten („Frontier“) in Auseinandersetzung mit der „Wildnis“ geformt und gehärtet. Doch nur bis ins späte 19. Jahrhundert hätten sich neu ankommende Siedler*innen qua Landnahme zu „echten“ Amerikaner*innen machen und im Stoffwechsel mit der Natur von ihren alten, „mitgebrachten“ Identitäten und Traditionen lösen können. Die Landmasse der USA hatte bis dahin immer noch ausreichend unerschlossenen Raum dafür geboten. Als der US Census im Jahr 1890 die Schließung der Frontier verkündete und damit nun offiziell alle Landstriche der USA für besiedelt erklärt waren, folgerte Turner, dass Zuwanderung nun zum Problem werden müsste, weil neu ankommende Menschen sich jetzt nicht mehr auf „natürlichem“ Wege amerikanisieren könnten und so zwangsläufig in ihren alten „unamerikanischen“ Denkmustern und Lebensweisen stecken bleiben würden.
In der Perspektive von Turners Frontier-Mythos – der bis in die 1930er zur Standardtheorie der US-amerikanischen Historiographie und Geschichtsbücher zählte (Susman 2003) – wurden die stetig wachsenden und von Zuwanderung geprägten Großstädte zum Sinnbild eines Auffangbeckens und Horts von ethnisch diversen und nicht-integrierbaren „fremden“ Einflüssen.
Zeitgleich brachte das Tin Pan Alley-Songrepertoire eine Unmenge Klischees ethnisierter Städter*innen hervor, etwa afro-amerikanische Glückspieler*innen und Tunichtsgute, betrunkene und raufende Ir*innen oder temperamentvolle und laute Italiener*innen (Hamm 1997, 22–101; UC Santa Barbara Library. o.D.a). Hatten Deutsche und Ir*innen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die zahlenmäßig größten Einwanderungsgruppen gestellt, nahm zur Jahrhundertwende vor allem der Anteil aus süd- und osteuropäischen Gebieten (z.B. Italien, Russland, Griechenland, Serbien und den Balkangebieten Österreich-Ungarns) zu. Gleichzeitig stieg durch eine verstärkte Black migration aus den ländlichen Südstaaten der Anteil von Afro-Amerikaner*innen in den nördlichen Metropolen. Wie Jennifer Mooney in ihrer Studie zu irischen Vaudeville-Stereotypen anmerkt, verschob sich dadurch auch der Fokus stärker auf diese nicht-angelsächsischen und nicht-protestantischen Gruppen (besonders osteuropäische Einwander*innen hatten oft einen jüdischen Hintergrund):
[T]he Irish were not the only group to be stereotyped by vaudeville performers. Dutch or German characters were also common, and by the 1880s and 1890s, as „new“ immigrants from Italy and Eastern Europe began to arrive in America in greater numbers, Italian and Jewish characters began to replace the Irish and Germans in vaudeville songs and sketches. Black Americans, of course, continued to be represented by white performers in blackface as vaudeville continued the traditions of the minstrel show. Vaudeville performers often assumed multiple ethnic and racial identities in their shows. The Polish-born team of Weber and Fields, for example, began their careers performing in blackface, in Dutch and Irish costumes and speaking in various dialects. Their opening theme song would announce „Here we are a colored pair,“ „an Irish pair,“ or a „Dutch pair“ as appropriate. (Mooney 2015, 41)
Diese urbanen, (zumeist) nicht-angelsächsischen und nicht-protestantischen Anderen der Vaudeville-Bühnen wurden als ungehemmte, hedonistische und lasterhafte Subjekte vorgestellt. Es war nicht unüblich, dass Performer*innen in gespielter Trunkenheit über die Bühne torkelten und komische Standups in Pseudo-Dialekten, „wilde“ Tanzeinlagen oder Slapstick-Prügeleien in ihre Songnummern einbauten, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Diese zur Schau gestellte Exzentrik und Exzessivität hielt die Bühnenfiguren auf Distanz zu puritanischen Werten und bürgerlicher Etikette, wie Henry Jenkins (1992) und M. Alison Kibler (1999) in ihren Untersuchungen zum Vaudeville-Humor herausgearbeitet haben. Wurden die oben beschriebenen Inszenierungen der kolonialen Anderen mit Verweis auf deren Naturzugehörigkeit auf Abstand zu weiß-hegemonialen Subjektvorstellungen und Zivilisation positioniert, so wurden Inszenierungen der urbanen Anderen vor allem mit Eigenschaften versehen, die ihnen die Anpassungsfähigkeit an ein zivilisiertes Stadtleben absprachen.
Auch auf den deutschen Bühnen kam es zu solchen Inszenierungen urbaner Anderer. Besonders jüdische Stereotype waren hier präsent. In den Dekaden rund um die Jahrhundertwende waren deutsche Großstädte von einer verstärkten jüdischen Migration geprägt, wie der Historiker Thomas Brechenmacher konstatiert:
Das deutsche Judentum […] war seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend und schließlich dominant ein großstädtisches Judentum. […] Während der Weimarer Republik kamen im Schnitt zwischen 70 und 75 Prozent der jüdischen Kinder in Großstädten zur Welt. (Brechenmacher 2011, 128)
De jure war Menschen jüdischen Glaubens im Deutschen Kaiserreich (1871–1918) das volle Anrecht auf Staatsbürgerschaft und auf die Ausübung sämtlicher Berufe zugesprochen worden, de facto blieben antisemitische Ausgrenzungen an der Tagesordnung. So waren etwa sozialer Aufstieg und das Bekleiden prestigeträchtiger Posten in Politik, Wissenschaft und Bildung die Ausnahme, wie Brechenmacher hinzufügt. Entsprechend war auf den Musiktheaterbühnen das Stereotyp der*des jüdischen Städters*in verbreitet, die*der um soziale Anerkennung bemüht ist und sich – gemäß eines verbreiteten antisemitischen Klischees – auf vielerlei „Heimtückeleien“ einlässt und vor „krummen“ Geschäften nicht zurückschreckt, so lange sie*er daraus opportun Gewinn ziehen kann. So stellt Tobias Becker mit Blick auf das Berliner Metropoltheater fest, dass „kaum eine der hier bis zum Ersten Weltkrieg gespielten Operetten oder Revuen […] ohne jüdische Charaktere aus[kam]. Vor allem die Figur des jüdischen Schelms findet sich sehr häufig“ (Becker 2014, 285). Auch Frederike Gerstner hebt in ihrer Studie hervor, wie die inszenierten „Assimilationsversuche“ von jüdischen Charakteren zu einer typischen „Zielscheibe des Spotts“ (Gerstner 2017, 206) im Berliner Theater wurden.
Während sich die protestantische Mehrheitsbevölkerung durch das Lachen über die unbeholfenen Anpassungsversuche der jüdischen Figuren ihrer selbst behaupteten kulturellen Überlegenheit versichern konnte, beinhalteten solche Verspottungen einen zweiten zentralen Abgrenzungsmechanismus. Mit Becker und Marline Otte ist davon auszugehen, dass sich ein fester Stamm des Berliner Musiktheaterpublikums auch aus sozial und ökonomisch besser gestellten Jüd*innen der gehobenen Mittel- und Oberschicht rekrutierte (Becker 2014, 228–31; Otte 2006, 205–10). Vor diesem Hintergrund ist auffällig, dass die Berliner Theaterproduktionen, im Bemühen, nicht Teile der eigenen Stammkundschaft zu vergraulen, eine weitere Differenzierung der stereotypen Charaktere vornahmen. Die jüdische Migration und Flucht vor Pogromen aus vornehmlich osteuropäischen Gebieten brachte seit den 1880er Jahren zwei „Pole jüdischer Identität“ (Brechenmacher 2011, 130) hervor, die entlang einer ethnisierten Grenzziehung zwischen Ost und West gespalten war. Diese Differenz spiegelte sich sehr unmittelbar auf den Musiktheaterbühnen wider. Otte hält für die Shows des Metropoltheaters fest:
There are consistent patterns in the Metropol’s depiction of Jews. For example, most Jewish characters revealed their Eastern European origins in the course of a scene. The established, assimilated Jewish community of Berlin was rarely ridiculed; the jokes were at the expense of the recent Jewish immigrants who could not shed their roots in Berlin’s „Jewish milieu“. (Otte 2006, 274)
Ethnisch markierte Jüd*innen der urbanen Unterschicht wurden also den alteingesessenen Jüd*innen der gehobenen Schichten gegenübergestellt. Letztere mussten sich dadurch nicht mit den Neuankömmlingen identifizieren und rückten durch das gemeinsame Verlachen der unbeholfenen Anpassungsversuche ein Stück weit mit der protestantischen Mehrheitsbevölkerung zusammen. Otte sieht dies auch mit Blick auf das Ensemble und das Produktionsteam des Metropoltheaters bestätigt, denn tatsächlich waren diese stereotypen Figuren und Handlungen von Julius Freund erdacht, der einer wohlhabenden jüdischen Familie aus Breslau entstammte und der in den 1900er und 1910er Jahren als Haustexter am Metropoltheater engagiert war (ebd., 229–32). Auch die in einer jüdischen Wiener Kaufmannsfamilie aufgewachsene Star-Sängerin Fritzi Massary (geboren Friederika Massaryk) gehörte für fast drei Dekaden – von 1904 bis zur Machtübernahme der Nazis 1933– zum festen Ensemble des Metropoltheaters. Massary hatte den Ruf, jeden erdenklichen Akzent und Part virtuos meistern zu können, doch nur in sehr wenigen Ausnahmen übernahm sie jüdisch markierte Charaktere (ebd., 236–39). Dies traf auch auf viele andere jüdische Performer*innen am Metropoltheater zu, wie Otte feststellt:
Most Jewish actors did not impersonate Jewish characters at the Metropol Theater. They might have feared, or possibly identified with, the prejudices of their upper-class audiences if they were to appear as Jewish characters drawn from the lower echelons of society. Because the Metropol used Jewish stage characters to enforce class boundaries, Jewish actors clearly did not care to find themselves in those roles. (Ebd., 239)
Hier wird deutlich, dass über die Inszenierungen von urbanen Anderen nicht nur Differenzen zwischen verschiedenen ethnischen Zugehörigkeiten, sondern auch zwischen verschiedenen Klassen verhandelt wurden. Mit anderen Worten: Die Musiktheaterbühne inszenierte hier Rassismen und Klassismen in intersektionaler Verschränkung, indem die urbanen Anderen durch ihre vorgebliche Primitivität die ethnisch „Fremden“ und gleichzeitig die „unkultivierten“ Unterschichten der Großstadt repräsentierten.

Körperpolitiken und Grenzüberschreitungen
Die „verAnderten“ Bühnenfiguren des Musiktheaters verkörperten genau jene Eigenschaften, die die bürgerliche Subjektkultur des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts als vermeidungswürdig erklärte. Die mangelnde Affektkontrolle, die rauschhaften Exzesse und die Tendenz zur hedonistischen Genussbefriedigung wiesen diese Figuren als nicht anpassungsfähig und unzivilisierbar aus. Wie ich bis hierhin argumentiert habe, untermauerte diese Differenz gesellschaftliche Hierarchien und reproduzierte so die symbolischen Ordnungen kolonialer, weißer, protestantischer und bürgerlicher Hegemonien. Wie ich allerdings im Folgenden zeigen möchte, kamen in solchen Inszenierungen auch die Kehrseiten und Ambivalenzen der Doppelstruktur der Differenz zum Tragen, da die vorgebliche Primitivität der rassifizierten bzw. ethnisierten Subjekte die verdrängten Begehren der bürgerlichen Gesellschaft spiegelten. Wie Andreas Reckwitz diese Ambivalenz der bürgerlichen Kulturhegemonie um 1900 auf den Punkt bringt, ist die
anti-primitive Unterscheidung doppelt anwendbar: Sie richtet sich gegen ganze Personengruppen, die insgesamt als Repräsentanten der negativ konnotierten Subjekteigenschaften erscheinen – nun das Proletariat, daneben auch die nicht-westlichen Kolonialvölker –; gleichzeitig visiert sie riskante Elemente an, die in jedem Subjekt, auch dem bürgerlichen, präsent und zu bekämpfen sind. Das Risiko eines Rückfalls ins Primitive scheint auch im Innern des bürgerlichen Subjekts zu lauern. (Reckwitz 2006, 249)
Es war ganz besonders das populäre Musiktheater, das dieser Ambivalenz sprichwörtlich eine Bühne bereitete. Die „verAnderten“ Bühnenfiguren lebten dem Publikum all jene Eigenschaften vor, die sich im gesellschaftlichen Alltag nicht anschickten. Mit dem Maskenspiel veranstaltete das Musiktheater ein Spektakel verpönter Lüste und Begehrensformen, wodurch immer auch symbolische Überdehnungen und Überschreitungen von scheinbar eindeutigen Grenzziehungen stattfanden.
In seiner Theorie des Karnevalesken begreift Michail Bachtin (1969) den Körper als Ort des potenziellen Widerstandes gegen gesellschaftliche Normen. Ich verstehe das Maskenspiel des Musiktheaters im Modus dieses Karnevalesken: Hatte die viktorianische und bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert ein Subjektideal hervorgebracht, das seinen Körper durch den Geist disziplinieren und im Zaum halten sollte, dann war die prononcierte Körperlichkeit der „verAnderten“ Bühnenfiguren dem diametral entgegengesetzt. Auf diese Weise forderten Performer*innen mit ihren Darstellungen prüde bürgerliche Moralvorstellungen heraus, woran sich Konflikte entzündeten. Etwa kam es immer wieder zu Kampagnen von elitären und christlichen Sittenwächter*innen, die gegen das in ihren Augen zu obszöne und freizügige Spektakel des Körpers wetterten (Erenberg 1981, 61–65; Peiss 1986, 97). In einer orchestrierten Polizeiaktion kam es zur Jahreswende 1908/09 beispielsweise zu Razzien in New Yorker Vaudeville-Theatern, bei denen auch einige Performer*innen vorübergehend in Gewahrsam genommen wurden (Erdman 2004, 28–32). Solche Maßnahmen blieben aber letztlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, da der Musiktheaterbetrieb die Grenze zum Skandalösen immer wieder auf ein Neues anvisierte und überschritt. Theatermanager, Showproduzenten und Performer*innen hatten erkannt, dass sich mit diesen Attraktionen ein zahlendes Publikum locken ließ.
Das prononcierte Spiel mit Körperlichkeit hatte besondere Implikationen für weiße Frauen. Weiße Performerinnen verkörperten auf den Musiktheaterbühnen Erotik und Sexualität in exotisierten, zumeist orientalisierten Kostümen, die den Blick auf entblößte Körperteile zuließen. Fraglos hatte es auch schon zuvor Darstellungen „fremdartiger“ Erotik gegeben, doch explodierten solche Orientalismen zahlenmäßig in den Dekaden ab 1890 förmlich. Die Historikerin Holly Edwards erkennt darin einen neu einsetzenden Orientalismus-Schub, infolgedessen der „Orient“ ein breites Arsenal an „metaphors and models for greater sensuality and liberated passions, relaxing enforcement of strict propriety“ (Edwards 2000, 45) bereitstellte. Performerinnen eigneten sich diese Symboliken und Semantiken an und übersetzten sie auf den Bühnen in transgressive Entwürfe von Weiblichkeit.
Im Jahr 1893 machte die armenische Tänzerin Fahreda Mahzar Spyropolos auf der Chicagoer Weltausstellung eine Bauchtanzvariante unter dem Namen „Little Egypt“ zu einer der Hauptattraktionen, die in der Folge von Performerinnen übernommen wurde und als „hoochie coochie“ in die Bühnenroutinen des Vaudeville und der Burlesque Einzug hielt (Brown 2008, 101). In den 1900ern und 1910ern gehörten schleiertanzende Salomes, Cleopatras, Radhas und Geishas auf den europäischen und nordamerikanischen Bühnen zum festen Programm. [4] Superstars wie Maud Allan, Ruth St. Denis, Adorée Villany, Mata Hari (Bühnenname der Niederländerin Margaretha Zelle), Gertrude Hoffmann und Eva Tanguay performten unterschiedliche Varianten dieser Tänzerinnen in sowohl sinnlichen als auch in frenetischen und exzentrischen Versionen.

In aufwendigeren Produktionen wurden deren Tanz-Nummern auch schon einmal von opulent ausstaffierten „indischen“ Tempelanlagen oder „arabischen“ Palastkulissen gerahmt, sogar echte Tiere, wie Schlangen oder Kamele, kamen gelegentlich zum Einsatz. Die Historiker Edward Ross Dickinson (2011) und Andrew Erdman (2004, 107–20 und 2012, 106–17) zeichnen nach, wie diese orientalisierten Tanzperformances immer wieder zu Skandalen führten. In den USA wurde Hoffmann etwa im Jahr 1909 für ihren freizügigen Act von der Bühne herab verhaftet und Villany musste sich sogar nach einer ihrer Tanzdarbietungen im Münchener Lustspielhaus im Jahr 1911 für öffentliche Unsittlichkeit vor Gericht verantworten, was für sie zwar mit Freispruch, aber auch mit einem Landesverweis aus Bayern endete (Dickinson 2011, 95–96).
An diesen heftigen Reaktionen wird evident, dass die Darstellung von körperlicher Expressivität und das Zeigen von Haut gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen sehr offensiv herausforderte. Gleichzeitig lässt sich der Rassismus und Sexismus hinter dieser als exotisch und erotisch inszenierten Weiblichkeit nicht kleinreden und viele Studien betonen, dass sich darin eine Form weißer Privilegierung äußerte. Durch Tanzperformances in orientalisierten Kostümen konnten weiße Frauen ihren transgressiven Weiblichkeitsentwurf absichern, nicht-weiße Frauen liefen dagegen Gefahr, damit ein gängiges Stereotyp zu perpetuieren. Denn während die viktorianische bzw. bürgerliche Kulturhegemonie von weißen Frauen sexuelle und körperliche Reinheit, Unschuld und Zurückhaltung forderte, wurde Frauen of Color dieser Subjektstatus systematisch abgesprochen. Letztere wurden in der damaligen Rasseideologie hypersexualisiert und primitivisiert und nur als „gross collection of desires, all uncontrolled“ gesehen, wie es die afro-amerikanische Autorin Marita Bonner (1925, 64) in ihrem Essay „On Being Young – a Woman – and Colored“ im Jahr 1925 rassismus- und sexismuskritisch zum Ausdruck brachte. David Krasner merkt deshalb zu den orientalisierten Tanzperformances an, dass die Intersektion von Rassismen und Sexismen für Performerinnen of Color eine völlig andere Ausgangslage bedeutete und mit völlig anderen Konsequenzen verbunden war:
For black women dancers, the deck was clearly stacked: stereotypes often prevented them from enjoying success even during a period of newfound interest in dance. Notions of sexuality in dance worked to reinforce the negative image of black women as primitive and inferior. (Krasner 2001, 194)
Performerinnen of Color entwickelten deshalb eigene Strategien. Wie Krasner in seiner Fallstudie zur afro-amerikanischen Star-Performerin Aida Overton Walker beobachtet, performte Walker ihren Salome-Tanz mit einem merklichen Unterschied zu weißen Performerinnen.

Im Jahr 1908 trat Walker mit diesem Act in der Schwarzen Broadway-Show Bandanna Land auf und 1912 tourte sie damit noch einmal durch die Vaudevilletheater. Mit Blick auf die zeitgenössischen Besprechungen ihrer Tanzperformance kommt Krasner zu dem Schluss, dass Walker die erotischen und exzessiven Elemente in ihrer Choreografie stark zurückgenommen haben muss und sich stattdessen vor allem auf die Dramaturgie ihrer Bewegungsabläufe konzentrierte, die sie anmutig und grazil gestaltete. Die Reviews beschreiben ihren Salome-Act etwa als „modest“, „graceful“ und „properly draped“ und heben dabei auch explizit den Unterschied zu den weißen Salome-Performerinnen hervor (ebd., 201–06). Dadurch nahm Walker zwar am Orientalismus-Spektakel der Salome-Tänzerinnen teil, bezog aber dennoch mit einem bewusst gewählten Abstand ihre ganz eigene Position.
Walker bleibt der einzige dokumentierte Fall einer Schwarzen Salome-Tänzerin im amerikanischen Musiktheater (Erdman 2004, 108). Auf Grund der grundsätzlich anders gelagerten Ausgangslage nicht-weißer Performerinnen und der zahlenmäßigen Überlegenheit weißer Performerinnen halten Musiktheaterhistoriker*innen fest, dass es vornehmlich letztere waren, die in Verkleidung einer orientalisierten Anderen mit dem Tabu brachen, körperliche Expressivität in der Öffentlichkeit darzustellen, um sich so symbolisch aus dem sprichwörtlichen Korsett viktorianischer bzw. bürgerlicher Weiblichkeit und einer restriktiven Sexualmoral herauszulösen. Jayna Brown schreibt: „For white women, performing fantasies of African American, as well as various types of native, femaleness provided moments of immunity from restrictive social protocol, a license for physical expression and self-possessed sexuality“ (Brown 2008, 100, Herv. i. O.). Auch Krystyn Moon formuliert in ihrer Studie zu chinesischen Bühnen-Stereotypen: „By becoming ‚Chinese,‘ […] white actresses had found an acceptable way to express their sexuality, a practice associated with the New Woman and her break with the Victorian mores that had denied respectable white women access to public spaces and their desires“ (Moon 2005, 113).
Ein gewichtiger Unterschied zu den weiter oben beschriebenen passivisierten und sexualisierten Frauenfiguren besteht darin, dass diese Tänzerinnen eine aktive und ausdrucksstarke Bühnenrolle einnahmen. Auf diese Weise brachten weiße Performerinnen in orientalisierter Verkleidung Entwürfe expressiver Weiblichkeit in Umlauf, die dann immer weitere Kreise zogen. In den späten 1910er Jahren erreichten sie den Stummfilm, als die Schauspielerin Theda Bara (Künstlerinnenname von Theodosia Burr Goodman und ein vom Filmstudio Fox erfundenes Anagram für „Arab death“) mit ihren Cleopatra- und Salome-Rollen sexuell angriffslustige sowie Männer kontrollierende und mordende Frauen verkörperte und damit zur ersten Sex-Ikone der Kinogeschichte wurde (Studlar 2011). Auch die erwähnte St. Denis ist mit ihren Tänzen in exotisierten Kostümen als Vorläuferin des freien Ausdruckstanzes bzw. des Modern Dance in die Geschichte eingegangen (Desmond 1991).
Die Expressivität, die diese Tänzerinnen hier in Verkleidung einer orientalisierten Anderen auf die Bühne brachten, erhob Anspruch auf ein erneuertes, vor allem offeneres Verhältnis zu Körper und Sexualität, das damalige weiße Weiblichkeitsnormen überschritt und für das es andernorts in der Gesellschaft kein Ventil gab. Damit bereiteten solche Tanz-Performances prototypisch Diskurse zu sexueller Selbstbestimmung und Verfügung über den eigenen Körper vor, die im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts insbesondere in feministischen Kontexten, aber auch darüber hinaus, immer wieder aufgegriffen wurden.
In anderer Hinsicht erlaubte das Maskenspiel das symbolische Überschreiten von Geschlechtergrenzen und heteronormativen Begehrensformen. Weibliche Gesangsstars der amerikanischen Vaudeville-, Revue-, Burlesque- und Musical Comedy-Bühnen wie May Irwin, Nora Bayes, Artie Hall oder Sophie Tucker nutzten hierfür eine doppelte Cross-Dressing-Strategie. Als so genannte coon shouter [5] eigneten sich diese Performerinnen die Position Schwarz und männlich markierter Protagonisten an und traten mit exzentrischen und prahlerischen Songperformances (zumeist) in Blackface auf (Kibler 1999, 111–42) – andere, wie die Performerin Maggie Cline, spezialisierten sich auf Songs mit betrunkenen und prügelnden „irischen“ Rowdys (ebd., 62). War die Praxis des Blackface zur Zeit der Minstrel Shows des 19. Jahrhunderts von Männern dominiert, so drangen um die Jahrhundertwende immer mehr Frauen in diese Domäne vor: „Through racial dialect and blackface, these white women gained comic license and adopted an uninhibited physical style, as men in the minstrel show had“ (ebd., 112).
Durch Einschreibung in diese mit Maskulinität assoziierte Praxis artikulierten Performerinnen einen Weiblichkeitsentwurf, der dem Bild der enthaltsamen und purifizierten weißen Frau nach Maßgabe des viktorianischen „cult of domesticity“ bzw. „cult of true womanhood“ (Cogan 2010) diametral entgegengesetzt war. Dieses hegemoniale Weiblichkeitsbild des 19. Jahrhunderts hatte weiße Frauen auf die Rolle in der häuslichen und familiären Sphäre reduziert und ihnen die Teilhabe an Öffentlichkeit abgesprochen. Mit der gesteigerten Präsenz von Frauen auf den Musiktheaterbühnen geriet diese viktorianische Festschreibung um die Jahrhundertwende ins Wanken und wie bei den orientalisierten Tänzerinnen wurde dieser Bruch mit dominanten Weiblichkeitsnormen durch die Mittel des Maskenspiels erzeugt.
Nicht nur durch visuelle Maskierung, sondern auch stimmklanglich setzten sich die weiblichen coon shouter durch harsche, angeraute und gepresste Vokalregister in Szene, die in damaligen Diskursen über Stimmbildung und in der Gesangspädagogik als primitiv diskutiert und mit einer Schwarzen Stimme in Verbindung gebracht wurden (Eidsheim 2015, 345–55). In zutiefst rassistischen Traktaten über die „gute“ Stimme definierte man harsche, raue und gepresste Stimm-Timbres als unkontrolliert (etwa als animalisch oder triebhaft), assoziierte sie mit einer evolutionären Vorstufe und stellte diese der „Perfektion“ des wohl gerundeten, klaren Tons gegenüber, der seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in der Opern-Tradition des Belcanto-Singens die Norm bildete (Smith 2008, 121–62).
Innerhalb dieses Bedeutungskontextes machte der vokale Exzess der weiblichen coon shouter einen Körper vorstellig, der sich keiner disziplinierenden Kontrollinstanz unterwerfen will und stattdessen einen Anspruch auf das Ausleben seiner libidinösen Regungen stellt. Sophie Tuckers Aufnahme des Ragtimesongs „That Lovin’ Rag“ (Edison Standard Record 10360, 1910; Musik: Bernard Adler, Text: Victor H. Smalley; siehe UC Santa Barbara Library. o.D.c) exemplifiziert diese für die coon shouter typische Klanglichkeit. Mit einer robusten und rufartigen (= Schwarz konnotierten) Gesangsstimme performt Tucker hier einen Körpereindruck, der sehr energiegeladen und nicht ruhiggestellt wirkt. Dazu singt sie mit einem afro-amerikanischen Akzent (wie z.B. Silbenelisionen auf „lovin’“ oder auch Slangausdrücke wie „gal“) aus einer im Songtext Schwarz und männlich markierten Position über das Ragtime-Tanzen mit einer Partnerin und beschreibt enge Umarmungen und lustvolle Gefühlszustände, die im letzten Chorus mit zwei orgiastischen „shouts“ bzw. „moans“ unterstrichen werden.
Durch Aneignung einer „männlichen“ und „Schwarzen“ Stimme und Perspektive vollzieht Tucker in diesem Song ein doppeltes vokales Cross-Dressing und singt aus dieser Position heraus über ihre erotische Zuneigung zu einer anderen Frau. Damit bietet sich die Möglichkeit, Tuckers Songperformance als Artikulation eines identitäts-ambiguen und queeren Begehrens zu hören, wodurch in mehrfacher Hinsicht mit naturalisierten Identitätskategorien und heteronormativen Begehrensformen gebrochen wird.
Wie bei den Salome-Tänzerinnen bleibt allerdings auch hier hinzuzufügen, dass solche transgressiven Entwürfe ein weißes Privilegdarstellten. Die Freiräume im Umgang mit Geschlecht und Sexualität ergaben sich eben gerade nicht durch die Auflösung von, sondern ganz im Gegenteil durch die Perpetuierung von rassifizierten Differenzen, da das Aufsetzen der schwarzen Maske und Stimme hier zur Möglichkeitsbedingung für das Spiel mit anderen Differenzmustern wurde.
Überschreibungen und „third spaces“
Damit konnten auch diese gegen den Strich gekehrten Porträtierungen den strukturellen Rassismus hinter diesen Verkörperungen nicht abschütteln. Auch solche körper- und identitätspolitischen Grenzüberschreitungen vermochten die verletzenden Stereotype des Maskenspiels nicht auszulöschen. Viele Autor*innen haben jedoch auch auf dekoloniale Performance-Strategien im Umgang mit den rassistischen Imaginationen der Bühnen hingewiesen. Performer*innen of Color nahmen am karnevalesken Spektakel des Musiktheaters teil und entwickelten ihre Bühnenfiguren oftmals mit direktem Bezug auf die allgegenwärtigen Stereotype. Studien etwa zum Schwarzen Musiktheater (Krasner 1997; Lotz 1997; Chude-Sokei 2006; Brown 2008), zu chinesisch-amerikanischen Vaudeville-Performer*innen (Moon 2005) oder zu jüdischen Musiktheaterstars (Rogin 1996) haben aufgearbeitet, wie es dabei regelmäßig zu parodistischen Überformungen und zu positiv gewendeten Überschreibungen von Klischees kam.
Das Maskenspiel bot die Möglichkeit, Repräsentationsmuster von Identitäten in Frage zu stellen, ad absurdum zu treiben und auf die Konstruiertheit von scheinbar essenziellen Differenzen hinzuweisen. Performances erkundeten in diesen Zusammenhängen oft jene hybriden Zwischenräume, die Homi Bhabha (1994) als postkolonialen „third space“ beschreibt: Hier greifen Dichotomien nicht, weil typische Entweder-Oder-Zuordnungen nicht mehr funktionieren.
Strukturell waren die Konventionen des popmusikalischen Mainstreams von den wirkmächtigen Vorstellungen der weißen Mehrheitsgesellschaft geprägt. Um am Musiktheaterbetrieb teilnehmen zu können, mussten Performer*innen of Color einen schmalen Grat zwischen vorurteilsbehafteten Haltungen eines weißen Publikums und positiv gewendeten Selbstrepräsentationen ausbalancieren. M. Alison Kibler weist auf den Unterschied zwischen den eben beschriebenen Performance-Strategien im Maskenspiel weißer Performerinnen und den weniger privilegierten Spielräumen von Performer*innen of Color im US-amerikanischen Vaudeville hin:
[M]anagers clearly accepted white women’s challenges to vaudeville’s ideal womanhood far more readily than they tolerated black performers’ attempts to cross the racial lines in vaudeville. Vaudeville permitted some play with both race and gender identities, but not to the same degree. White women’s increasing use of racial masquerades indicates a freedom in performance choices that black performers were often denied. (Kibler 1999, 118)
Die größten Vaudeville-Theater und Booking Agencies waren fest in den Händen weißer Manager, die Performer*innen of Color oft nur ins Programm nahmen, wenn deren Acts den verbreiteten Bühnen-Stereotypen entsprachen. Die Fähigkeit, etwas anderes darzustellen, wurde ihnen sogar systematisch abgesprochen (ebd., 116). Sie sollten letztlich zu leibhaftigen Kopien der stereotypen Masken-Identitäten werden. Immer wieder jedoch machten Performer*innen of Color durch performative Interventionen deutlich, dass solche Figuren nichts weiter als rassistische Bühnen-Fiktionen sind.
Derartige Strategien hat Krystyn Moon (2005) für chinesisch-amerikanische Vaudeville-Performer*innen rekonstruiert, die mit ihren Acts diverse Stereotype und musikalische Repertoires ineinander überblendeten. Lee Tung Foo, The Chung Hwa Comedy Four, Prince Lai Mon Kim und Rose Elanor Jue aka Princess Jue Quon Tai sind heute kaum bekannte Namen in der US-amerikanischen Musiktheatergeschichte, weil sie systematisch aus dieser herausgeschrieben wurden, obwohl sie auf den damaligen Bühnen durchaus erfolgreiche Karrieren bestritten. Moons Studie ist außerordentlich verdienstvoll, weil sie die Laufbahnen dieser Performer*innen detailliert verfolgt. Sie zeigt, wie diese in ihren Acts einerseits – in der Regel auf Wunsch der Theater-Manager – mit „Yellowface“-Nummern, Chinatown-Songs in klischeehaften Pidgin-Dialekten und „chinesischen“ Kostümen verbreitete Vorurteile bedienten, gleichzeitig porträtierten sie aber auch „irische“, „schottische“ und Blackface-Figuren, sangen „deutsche“ Trinklieder, romantische Balladen, Barber Shop-Quartette und populäre Opernarien (ebd., 146–62). Besonders Lee Tung Foo war für seine Vielseitigkeit bekannt, eine Highlander-Routine im schottischen Kilt gehörte dabei zu seiner populärsten Nummer.

Dazu belegt Moon durch zeitgenössische Reviews, dass Lee in der Lage war, das Publikum durch seine vielseitigen Gesangsqualitäten zum Überdenken von rassistischen Wahrnehmungsmustern zu bewegen:
Lee Tung Foo often received extensive commentary on his singing ability because his act was considered so novel and groundbreaking. It seems almost silly, but it was such a widespread belief that men and women of Chinese descent could not understand European or American music that people were truly dumbfounded to hear him. (Ebd., 154)
Durch Hybridisierungen, aber auch unter Beweisstellung jener Fähigkeiten, die ihnen gemäß verbreiteter Vorurteile abgesprochen wurden, erlangten chinesisch-amerikanische Performer*innen Kontrolle über ihre eigenen Images und durchbrachen Klischees, wodurch koloniale Denkmuster ihre Deutungshoheiten verloren oder zumindest für den Moment der Bühnen-Performance ihrer Wirkungskraft beraubt wurden.
Für die europäischen Bühnen hat Rainer E. Lotz ganz ähnliche Strategien für die Tourneen Schwarzer Performer*innen dokumentiert. Unter anderem porträtiert er eine in San Francisco gegründete Musiktheatergruppe namens „The Black Diamonds“, die in den Jahren von etwa 1905 bis 1922 mit einer Reihe an verschiedenen Acts in Detuschland auftraten (Lotz 1997, 257–82; siehe auch Green, Lotz und Rye 2013, 201–8). Weil die Überlieferungen viele Lücken beinhalten, ist nicht ganz klar, ob diese Teil eines größeren und lose zusammenhängenden Kollektivs waren, aus dem heraus sich über die Jahre verschiedene Duos, Trios und Quartette rekrutierten, oder ob es sich dabei um mehrere voneinander unabhängige Ensembles handelte, die in diesem Zeitraum als „Black Diamonds“ durch den deutschsprachigen Raum (und darüber hinaus) tourten.
Auf jeden Fall bedienten diese Gruppen ein breiteres Repertoire und machten, wie die eben genannten chinesisch-amerikanischen Performer*innen, von vielfältigen Varianten des Maskenspiels Gebrauch. Eine damit in Verbindung stehende Trio-Formation gab in den Jahren zwischen 1906 und 1911 etwa als „The Black Highlanders“ mit einem – in zeitgenössischen Programmen als „exzentrisch“ beschriebenen (Lotz 1997, 259–62) – Song-und-Tanz-Act in schottischen Kilts zahlreiche Konzerte. [6] Besonders beliebt scheint beim deutschen Publikum ein regelmäßig aufgeführter Act in alpinen Lederhosen-Trachten gewesen zu sein, bei dem die „Black Diamonds“ Jodel- und Schuhplattler-Einlagen – wohl teilweise in Kombination mit Steptanz-Elementen (ebd., 270) – zum Besten gaben.
Weiterhin zeichnet Lotz den außerordentlich erfolgreichen, über dreißig Jahre währenden Karriereverlauf der Afro-Amerikanerin Arabella Fields nach (ebd., 225–45; siehe auch Green, Lotz und Rye 2013, 242–47), die im Jahr 1894 mit einer Minstreltruppe nach Europa kam und sich anschließend in Deutschland niederließ. Fields war für Songs aus der Tradition der Minstrel Shows des 19. Jahrhunderts bekannt, doch genauso wie bei den „Black Diamonds“ waren ihre deutschen Lieder und Jodel-Einlagen im Dirndl-Outfit der eigentliche Publikumsmagnet, wie Lotz durch Konzertreviews und Ankündigungstexte nachweist. Natürlich fußte das Spektakel Schwarzer Performer*innen in Trachten weiterhin auf einer Logik der Exotisierung. Doch nutzten die „Black Diamonds“ und Fields die Konventionen des Maskenspiels hier in einer Art, die das typisch koloniale Schema aufbrach, indem sie die Bühnenpräsenz ihrer – durch den Publikumsblick mit klischeehaften Zuschreibungen behafteten – Körper mit einem alpinen Folklore-Stereotyp verbanden und überlagerten. Dass solche Acts über einen so langen Zeitraum erfolgreich funktionierten, deutet darauf hin, dass es im Musiktheater nicht zwangsläufig auf die Bestätigung essenzialistischer Vorstellungen hinauslief, sondern dass die spielerische oder ironische Überformung solcher Klischees einen ebenso großen Zuspruch beim zeitgenössischen Publikum fand.


Für das US-amerikanische Schwarze Musiktheater hat David Krasner (1997) rekonstruiert, wie es auch hier regelmäßig zu Parodien und Überschreibungen kam. Krasner blickt auf den Broadway, wo in den 1890ern und 1900ern die ersten ausschließlich von Schwarzen konzipierten und besetzten Musical Comedies spielten. Diese ersten Schwarzen Broadway-Casts rund um die Star-Performer*innen Bert Williams, George Walker, Bob Cole, Ernest Hogan und Aida Overton Walker traten häufig mit coon songs und in Blackface auf und mobilisierten so in einem ersten Schritt rassistische Stereotype, um sie dann in einem zweiten Schritt als ebensolche zu entlarven und mit anderen Bedeutungen zu überschreiben. Die Strategie der Überschreibung kämpft, so Krasner, auf dem gleichen Terrain und mit genau jenen Waffen, die die hegemoniale Kultur zur Verfügung stellt (ebd., 26). Anstatt also den strukturellen Rassismus des Musiktheaters offen zu attackieren – was in Anbetracht der massiven Macht, die das weiße Showbusiness über die Performancekonventionen ausübte, einem aussichtslosen Unterfangen geglichen hätte –, wurden Stereotype von innen heraus unterhöhlt.
Schwarze Musiktheater-Performer*innen eigneten sich die pseudo-afro-amerikanischen Dialekte, Slangausdrücke und rassistischen Bezeichnungen der damals populären coon songs (wie beispielsweise „coon“ oder „darky“) an, „stahlen“ damit den rassistischen Humor aus dem Mund der Weißen und erlangten so Kontrolle über die Verwendung dieser Sprache (ebd., 36). Aus dem rassistischen Sinnarsenal der Blackface Minstrelsy und coon songs bezogen diese Performer*innen eine eigene Sprecher*innenposition; eine Strategie, die auch später im Blues der 1920er Jahre, etwa bei Ma Rainey oder Bessie Smith, ihre Fortsetzung fand (siehe hierzu Antelyes 1994; Abbott und Seroff 2007).
Wie eine solche Überschreibung sich konkret performativ äußerte, hat Camille Forbes (2004) für den Vaudeville-Act von Bert Williams untersucht. Williams, der in den 1910er Jahren zu den Topverdienern im US-amerikanischen Showbusiness gehörte, wurde als Solo-Act in den prestigeträchtigsten Vaudeville-Theatern und Revuen als Headliner gebucht und hatte wohl auf Grund seines Star-Status einen größeren Handlungsspielraum als weniger bekannte Schwarze Performer*innen. Es ist freilich schwer, aufgrund fehlender Live-Aufnahmen den tatsächlichen Ablauf seiner Auftritte zu rekonstruieren. Aus vielen erhaltenen Fotografien, Songaufnahmen und zwei Stummfilmen („Fish“ und „A Natural Born Gambler“, beide Biograph, 1916; siehe The Riverbends Channel 2015 und 2012) lässt sich zumindest ableiten, wie Williams durch Kleidung, Mimik, Gestik, Sprache und Klang mit stereotypen Überzeichnungen gearbeitet hat. Auch Williams nahm coon songs in überzogenen pseudo-afro-amerikanischen Dialekten und Slang auf, aber immer wieder dekonstruierte er, wie Tim Brooks (2005, 105–48) und Tilo Hähnel (2014) in ihren Songanalysen feststellen, die klischeehaft Schwarz markierten Songprotagonisten durch „gehobene Aussprache, Ironie, Wortwitz und das überdeutliche Timing der Konsonanten“ (ebd., 10). Auf der Vaudeville-Bühne performte Williams als Song-Komiker in Blackface und mit Kraushaarperücke, trug übergroße Schuhe und einen zu kurz geschnittenen Anzug mit abgerissenem Frack.

Forbes bezieht sich in ihrer Analyse auf zeitgenössische Quellen, aus denen hervorgeht, dass Williams besonders mit einem verlangsamten Timing und Pausen gearbeitet zu haben scheint. Dabei trat er sehr zögerlich durch den geschlossenen Vorhang auf die Bühne, indem er stückweise einzelne Körperteile voran schob: Zunächst die Hände, dann einen Arm und eine Schulter bis schließlich der ganze Körper zu erkennen war. Durch diese Entschleunigung brachte er das an schnelllebiges Musiktheater-Spektakel gewöhnte Publikum dazu, die Performativität seiner körperlichen Handlungen genauestens nachzuvollziehen. In den Worten von Forbes:
Although Williams’s character was informed by the minstrel „darky“ type, he performed it with a notable difference that began by showing the performative frame into which he introduced the fictional character. Rather than emphasize the timelessness of the stereotype that would restrict the possibilities of his performance, he underscored the specificity of that performance. Through this particular and specific performative moment, which the establishment of his performance space (stepping into the area before the curtain, standing in the spotlight) indicated and affirmed, Williams created a break in the action of the hectic vaudeville show, which called attention to itself. By doing so, he allowed for a new performative instance by which there might be an opportunity to break the „stylized repetition of acts“ through which his performance of blackness was read and interpreted by audiences, moving towards a new articulation of this presumably culturally and historically predetermined character. (Forbes 2004, 612)
Indem Williams von hyperbolischen und exzessiven Handlungsvollzügen absah und seine Blackface-Figur mit einer bewussten Langsamkeit in Szene setzte, erfüllte er nicht das gängige Bühnen-Klischee des primitiven und impulsiven Schwarzen Charakters. Seine entschleunigte Blackface-Figur konnte so nicht mehr mit Hilfe herkömmlicher Differenzmarker dechiffriert werden. Zwar war seine Figur durch das rassistische Blackface-Stereotyp informiert, doch entglitt sie durch die Verlangsamung den vorgefertigten Festschreibungen und Erwartungshaltungen in den entscheidenden Momenten und erspielte sich eine Position, die nicht mehr in das Raster kulturell produzierter Unterscheidungen hineinpasste.
Williams und andere Schwarze Performer*innen, die in Blackface auftraten, waren beim zeitgenössischen Schwarzen Publikum durchaus akzeptiert und beliebt. Doch mussten sie oftmals auch heftige Kritik von der progressiven afro-amerikanischen Presse einstecken (Brooks 2005, 120; Abbott und Seroff 2007, 87–92), die ihnen den Vorwurf machte, problematische und entfremdende Stereotype zu perpetuieren. In einer Phase, in der sich in den USA einflussreiche Schwarze Bürgerrechtsorganisationen wie die National Association for the Advancement of Colored People(1909) gründeten und Diskurse um racial pride zum Politikum wurden, forderten militante afro-amerikanische Kritiker*innen von Williams einen „authentischen“ Schwarzen Gegenentwurf, den Williams, in seiner Weigerung die Maske abzulegen, nicht gab (Chude-Sokei 2006, 48).
Louis Chude-Sokei liest Williams’ Gebrauch von Blackface und seine Verweigerung, einen eindeutigen Gegenentwurf einer Schwarzen Identität zu präsentieren, als performative Strategie, die Williams ganz bewusst wählte, weil er kein Afro-Amerikaner war, sondern in Nassau, auf den heutigen Bahamas (damals die „British West Indies“), geboren wurde und als Kind mit seiner Familie in die USA gezogen war (ebd.). Williams gehörte damit selbst zu einer migrantischen afro-karibischen Minderheit innerhalb der afro-amerikanisch dominierten Schwarzen Community der USA und nutzte das Maskenspiel, um damit die strikt binäre Unterscheidung zwischen einem weißen und Schwarzen Amerika weiter aufzubrechen.
In einem Artikel, der im Jahr 1918 im American Magazine erschien, schrieb er: „I took to studying the dialect of the American negro, which to me was just as much a foreign dialect as that of the Italian“ (Williams 1918, 60) und erklärte damit rückblickend, wie er in den 1890er Jahren als noch unbekannter Performer im US-amerikanischen Showgeschäft nur Fuß fassen konnte, weil er sich einen afro-amerikanischen Bühnen-Dialekt zugelegt hatte, um gemäß den Konventionen des Musiktheaters als Figur eines „Afro-Amerikaners“ zu funktionieren. Das stereotype Maskenspiel hatte für diesen Performer mit afro-karibischen Migrationshintergrund also noch einmal eine ganz andere Bedeutung als für seine afro-amerikanischen Kolleg*innen. Für einen Superstar von Williams’ Kaliber wäre es auf dem Höhepunkt seiner Karriere in den 1910er und 1920er Jahren womöglich eine Option gewesen, auf den Einsatz der Blackface-Maske zu verzichten, doch blieb er bis zu seinem Tod im Jahr 1922 bei dieser Strategie, was Chude-Sokei zu folgender Deutung veranlasst:
For this comedic performer [Williams, S.J.], blackface masquerade was as much a means of negotiating relationships between and among diaspora blacks in Harlem as it was an attempt to erase the internationally projected racist fiction of the „stage Negro“ (or „darky“) from within the conventions of popular performance, from behind a mask produced and maintained by competitive projections and denials of black subjectivity. (Chude-Sokei 2006, 8–9)
In Chude-Sokeis Lesart nutzte Williams sein Maskenspiel also nicht nur, um – wie in der oben dargelegten Deutung von Forbes – rassistische Stereotype zu dekonstruieren, sondern auch um damit simple Entweder-Oder-Schemata zu verkomplizieren und aufzufalten. In der Weigerung, Identität auf eine essenzialistische Zuschreibung festzuzurren – auf keinen Fall weiß, aber auch nicht dezidiert „authentisch“ Schwarz –, nahm seine Blackfacefigur in einem Zwischenraum Platz, der darauf verwies, dass Prozesse der Identitätsbildung nicht reibungsfrei in dichotomen Differenzzuschreibungen aufgehen können.
Postkoloniale Theorie und historische Popmusikforschung: Ein Fazit
Wie dieser Text dargelegt hat, war das europäische und nordamerikanische populäre Musiktheater der Jahre 1890 bis 1930 von Konventionen des Maskenspiels dominiert. Dabei kam es zur Darstellung einer ganzen Reihe an vor allem rassistisch überzeichneten Bühnenfiguren. Diese Inszenierungen „verAnderter“ Subjekte dürfen, so wird in den einzelnen Abschnitten deutlich, nicht monolithisch als Ausdruck westlicher Überlegenheitsvorstellungen und kolonialer Herrschaftsansprüche verstanden werden, sondern sie waren mit durchaus sehr heterogenen gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen verwoben.
Das populäre Musiktheater war damit mehr als nur ein Ort, an dem groteske Rassismen perpetuiert und Bevölkerungsgruppen ins Lächerliche gezogen wurden, um damit koloniale und paternalistische Machtverhältnisse aufrecht zu erhalten. Das Maskenspiel ermöglichte Performer*innen auch körper- und identitätspolitische Interventionen, durch die Alternativen zu herrschenden symbolischen Ordnungen artikuliert wurden. Dies habe ich als Doppelstruktur und Ambivalenz der Differenz beschrieben: Darstellungen von „verAnderten“ Subjekten konnten zwischen Aversion und Faszination hin und her pendeln und öffneten darüber hinaus Räume, die jenseits von Entweder-Oder-Dichotomien lagen. Auch wurde deutlich, dass sich rund um diese Figuren gesellschaftliche Diskurse zu Identität und Körperbildern bzw. dem Stellenwert des Körpers entzündeten.
Vor zwei Dekaden stellte Peter Wicke (2001) mit Rückblick auf das damals gerade zu Ende gegangene Jahrhundert die Diagnose, dass der Siegeszug der populären Musik im 20. Jahrhundert sehr zentral mit der Erschließung von Körperlichkeit und der Artikulation von Identitäten und Begehrensformen zusammenhängt. Populäre Musik avancierte dabei zum „heftig umkämpften Terrain“ (ebd., 14), das gesellschaftliche, kulturelle, politische und ökonomische Bereiche aneinander band, die sich schließlich auch global vernetzten. Sie wurde zum
Ort, an dem sich Subjektivitätsformen vermitteln, jene Werte- und Wunschproduktion stattfindet, ohne die der Gesellschaftskörper seinen inneren Zusammenhalt verlieren, im Spannungsfeld der vermittlungslosen Triebkräfte von Wirtschaft und technischem Fortschritt zerrissen und zerrieben würde. Im 20. Jahrhundert ist dieses Terrain […] durch die fast grenzenlose Pluralisierung der Codes kultureller Identitäten enorm ausdifferenziert und entsprechend vergrößert worden, hat mit der Erschließung des Körpers als einer kulturellen Ikone immer weiterreichende Dimensionen erhalten. (Ebd.)
Hier lässt sich abschließend postulieren, dass die Aushandlung und Ausdifferenzierung von Identitätskonstrukten, Körperbildern und Begehrensformen mit dem Aufstieg der Massenkultur und der kommerziellen Unterhaltungsindustrie um 1900 einen mächtigen Schub erfuhr und dass hier womöglich der Startschuss für jene von Wicke ausgemachten historischen Entwicklungen gegeben wurde. Gerade weil in diesen Jahren die Sichtbarkeit von Frauen und People of Color auf den populären Musiktheaterbühnen deutlich zunahm, multiplizierten sich Strategien und performative Interventionen in der popkulturellen Arena erheblich.
In den 1920ern begann das Musiktheater seine Vorreiterrolle in der Popmusiklandschaft einzubüßen. Die Weltwirtschaftskrise ab 1930 besiegelte dessen Schicksal endgültig. Die neu aufkommenden technischen Medien, das Radio und der Tonfilm bzw. konkret das Filmmusical, verdrängten und beerbten das Musiktheater in dessen Funktion als popmusikalisches Massenmedium und schufen im gleichen Zuge neue Räume für Inszenierungen von Identitäten, Körpern und Begehrensformen auf Leinwand oder durch Lautsprecher im heimischen Wohnzimmer. Damit verschwand das Musiktheater in seinen damaligen Formen und mit seinen Konventionen des Maskenspiels und machte neuen Formen und Konventionen Platz.
Was bis in die Gegenwart blieb, sind Muster rassistischer, sexistischer und anderer identitätsbasierter Diskriminierungsformen, wenngleich diese sich in stets verändernden Gesellschaftsformationen in immer wieder unterschiedlichen Ausprägungen zeigen. Sie erfinden – auch ohne wortwörtliches Maskenspiel – fortwährend neue „Verkleidungen“, so dass die Popmusikforschung hier vor der Herausforderung steht, diese Strukturen in ihrer historischen Spezifität zu beleuchten und offen zu legen. Die von mir vorgenommene Anwendung postkolonialer Theorie auf historisch konkrete Fälle darf als Möglichkeit und Anregung für ein solches Projekt verstanden werden.
Zum Autor
Steffen Just ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Musikwissenschaft der Universität Potsdam. Er forscht und lehrt mit Schwerpunkt auf Popmusikgeschichte des 20. Jahrhunderts und populärer Musik der Gegenwart, Performance und Sound Studies, zu Musik in den technischen Medien und zu Artikulationen von Identitäten in der populären Musik. 2019 war er Fellow am Exzellenzcluster „Contestations of the Liberal Script“ der Berlin University Alliance (Freie Universität Berlin). Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theorie und Geschichte der Populären Musik am Musikwissenschaftlichen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin (2017–2019). Im Jahr 2018 schloss er dort seine Promotion mit dem Titel Performances zwischen Anderem und Selbst. Eine Geschichte des Subjekts in der US-amerikanischen populären Musik, 1890–1960 ab.
Anmerkungen
[1] Bei Bühnenstücken beziehen sich die Jahreszahlen in Klammern immer auf das Jahr der Uraufführung, bei Songtiteln beziehen sie sich auf das Veröffentlichungsjahr.
[2] Blackface bezeichnet die rassistische Praxis weißer Performer*innen, ihr Gesicht durch Ruß oder Schminke dunkel zu färben, um so die Bühnenfigur eines Schwarzen Subjekts in grotesk überzeichneter Form aufzuführen und bloßzustellen. Meist ging dies mit der Entstellung anderer Körperteile einher: Vergrößerungen von Nasen, das Hervorquellen der Lippen- und Augenpartien, zerlumpte oder schlecht passende Kleidung, übergroße Schuhe etc. Blackface wurde mit dem Aufkommen der amerikanischen Minstrel Shows in den 1830er Jahren popularisiert und alsbald auf den Musiktheaterbühnen zur gängigen Konvention (Lott 1993). Durch transatlantischen Verkehr hatte Blackface bereits im 19. Jahrhundert die europäischen Bühnen erreicht und war in allen hier behandelten Musiktheaterformaten der Jahre 1890 bis 1930 weit verbreitet (siehe Lhamon 1998; Gerstner 2017).
[3] Diese in Serie produzierten Sexismen und Fantasien einer patriarchalen Inbesitznahme wurden von den Strukturen der Musikökonomie systematisch befördert. Denn die Songschmiede der US-amerikanischen Tin Pan Alley, in der diese Songs für das Musiktheater produziert wurden, war fest in den Händen männlicher Songwriter, Texter und Verleger (Suisman 2009, 18–56) – das war im Übrigen auch in der englischen und deutschen Musikindustrie der Fall. Koloniale und ökonomische Strukturen griffen so in diesen Jahren ineinander und festigten das Machtgefälle des Patriarchats.
[4] In der Spielzeit 1908/1909 kam es in den USA etwa zu einer regelrechten „Salome-Welle“. Ein Artikel in der amerikanischen Monatszeitschrift Current Literature berichtete im Oktober 1908 allein für die New Yorker Vaudeville-Spielpläne von 24 verschiedenen Salome-Acts (Krasner 2001, 200).
[5] Der Begriff coon war ein damals weit verbreiteter rassistischer Ausdruck. Unter der Kategorie coon songs wurden Songs zusammengefasst, in denen textlich afro-amerikanische Songprotagonist*innen auftraten. In Musiktheaterprogrammen war es geläufig, Blackface-Performer*innen als coon shouter anzukündigen.
[6] Lotz gibt hier Textauszüge aus diversen Veranstaltungsankündigungen bzw. Reviews der „Black Highlanders“ aus dem deutschsprachigen Raum wieder. Dokumentiert sind u.a. Auftritte in Bremen, Hamburg, Teplitz (Böhmen), Bern, Frankfurt am Main, Augsburg, Göttingen, Düsseldorf, Bonn, Aachen, Essen, Eisenach und Duisburg. Darüber hinaus ist auch ein Gastspiel in St. Petersburg nachgewiesen.
Quellenverzeichnis
Abbott, Lynn und Doug Seroff. 2007. Ragged but Right. Black Traveling Shows, „Coon Songs“, and the Dark Pathway to Blues and Jazz. Jackson: University of Mississippi Press.
Ahmed, Sara. 2006. Queer Phenomenology. Orientations, Objects, Others. Durham: Duke University Press.
Antelyes, Peter. 1994. „Red Hot Mamas. Bessie Smith, Sophie Tucker, and the Ethnic Maternal Voice in American Popular Song.“ In Embodied Voices. Representing Female Vocality in Western Culture, herausgegeben von Leslie C. Dunn und Nancy Jones, 212–29. Cambridge: Cambridge University Press.
Bachtin, Michail. 1969. „Grundzüge der Lachkultur.“ In Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur, herausgegeben und übersetzt von Alexander Kämpfe, 32–46. München: Carl Hanser.
Becker, Tobias. 2014. Inszenierte Moderne. Populäres Theater in Berlin und London, 1880–1930. München: Oldenbourg.
Bhabha, Homi. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.
Blanchard, Pascal, Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch, Éric Deroo und Sandrine Lemaire. 2008. Human Zoos. Science and Spectacle in the Age of Colonial Empires. Liverpool: Liverpool University Press.
Bonner, Marita. 1925. „On Being Young – a Woman – and Colored.“ Crisis 31 (2): 63–65. [Reprint: Bonner, Marita. 1993. „On Being Young – a Woman – and Colored.“ In Blacks at Harvard. A Documentary History of African-American Experience at Harvard and Radcliffe, herausgegeben von Werner Sollors, Caldwell Titcomb und Thomas A. Underwood, 230–34. New York: New York University Press].
Born, Georgina und David Hesmondhalgh. 2000. Western Music and Its Others. Difference, Representation, and Appropriation in Music. Berkeley: University of California Press.
Brechenmacher, Thomas. 2011. „Jüdisches Leben im Kaiserreich.“ In Das deutsche Kaiserreich 1890–1914, herausgegeben von Bernd Heidenreich und Sönke Nietzel, 125–41. Paderborn: Ferdinand Schönigh.
Brooks, Tim. 2005. Lost Sounds. Blacks and the Birth of the Recording Industry 1890–1919. Urbana: University of Illinois Press.
Brown, Jayna. 2008. Babylon Girls. Black Women Performers and the Shaping of the Modern. Durham: Duke University Press.
Chude-Sokei, Louis. 2006. The Last „Darky“. Bert Williams, Black-on-Black Minstrelsy, and the African Diaspora. Durham: Duke University Press.
Cogan, Frances B. 2010. All-American Girl. The Ideal of Real Womanhood in Mid-Nineteenth-Century America. Athens: University of Georgia Press.
Crenshaw, Kimberlé W. 1991. „Mapping the Margins. Intersectionality, Identity, Politics, and Violence against Women of Color.“ Stanford Law Review 43 (6): 1241–99.
Degele, Nina und Gabriele Winker. 2009. Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. Bielefeld: transcript.
Derrida, Jacques. 1972. Positions. Chicago: University of Chicago Press.
Desmond, Jane. 1991. „Dancing Out Difference. Cultural Imperialism and Ruth St. Denis’s ,Radha‘ of 1906.“ Journal of Women in Culture and Society 17 (1): 28–49.
DeWolf Hopper, William und Wesley Winans Stout. 1927. Once a Clown, Always a Clown. Reminiscences of DeWolf Hopper. Boston: Little, Brown and Company.
Dickinson, Edward Ross. 2011. „,Must We Dance Naked?‘ Art, Beauty, and Law in Munich and Paris, 1911–1913.“ Journal of the History of Sexuality 20 (1): 95–131.
Edwards, Holly. 2000. Noble Dreams, Wicked Pleasures. Orientalism in America, 1870–1930. Princeton: Princeton University Press.
Eidsheim, Nina Sun. 2015. „Race and the Aesthetics of Vocal Timbre.“ In Rethinking Difference in Music Scholarship, herausgegeben von Olivia Bloechel, Melanie Lowe und Jeffrey Kallberg, 338–65. Cambridge: Cambridge University Press.
Erdman, Andrew. 2004. Blue Vaudeville. Sex, Morals and the Mass Marketing of Amusement, 1895–1915. Jefferson: McFarland & Company.
Erdman, Andrew. 2012. Queen of Vaudeville. The Story of Eva Tanguay.Ithaca: Cornell University Press.
Erenberg, Lewis A. 1981. Steppin’ Out. New York Nightlife and the Transformation of American Culture, 1890–1930. Westport: Greenwood Press.
Everett, William A. 2007. „Chu Chin Chow and Orientalist Musical Theatre in Britain During the First World War.“ In Music and Orientalism in the British Empire, 1780s–1940s. Portrayal of the East, herausgegeben von Martin Clayton und Bennett Zon, 277–96. Aldershot: Ashgate.
Forbes, Camille. 2004. „Dancing with ,Racial Feet‘. Bert Williams and the Performance of Blackness.“ Theatre Journal 56 (4): 603–25.
Ganz, Kathrin und Jette Hausotter. 2020. Intersektionale Sozialforschung. Bielefeld: transcript.
Garrett, Charles Hiroshi. 2008. Struggling to Define a Nation. American Music and the Twentieth Century. Berkeley: University of California Press.
Gerstner, Frederike. 2017. Inszenierte Inbesitznahme. Blackface und Minstrelsy in Berlin um 1900. Stuttgart: J.B. Metzler.
Green, Jeffrey, Rainer Lotz und Howard Rye. 2013. Black Europe. Band 1. Holste-Oldendorf: Bear Family Productions.
Hähnel, Tilo. 2014. „Vokale Ausdrucksmuster im Kontext von Star-Images und kulturellen Stereotypen. Eine exemplarische Analyse der Vokalstile von Bert Williams und Bing Crosby.“ In Samples. Online-Publikationen der Gesellschaft für Popularmusikforschung / German Society for Popular Music Studies e.V., 12, herausgegeben von Ralf von Appen, André Doehring und Thomas Phleps. Zugriff am 31.05.2020. www.gfpm-samples.de/Samples12/haehneletal.pdf.
Hall, Stuart. 1996. „Who Needs ,Identity‘?“ In Questions of Cultural Identity, herausgegeben von Stuart Hall, 1–17. London: Sage.
Hall, Stuart. 1997. „The Spectacle of the Other“. In Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, herausgegeben von Stuart Hall, 223–79. London: Sage.
Hamm, Charles. 1997. Irving Berlin. Songs from the Melting Pot. The Formative Years 1907–1914. New York: Oxford University Press.
Hobsbawn, Eric. 1987. The Age of Empire, 1875–1914. New York:Pantheon.
Ismaiel-Wendt, Johannes. 2011. tracks‘n‘treks. Populäre Musik und postkoloniale Analyse. Münster: Unrast.
JeffsGreats. 2014. „AL JOLSON Sings a few of his biggest Hit’s 1926.“ YouTube. Link.
Jenkins, Henry. 1992. What Made Pistachio Nuts? Early Sound Comedy and the Vaudeville Aesthetic. New York: Columbia University Press.
Kibler, M. Alison. 1999. Rank Ladies. Gender and Cultural Hierarchy in American Vaudeville. Chapell Hill: University of North Carolina Press.
Knapp, Raymond. 2005. The American Musical and the Formation of National Identity. Princeton: Princeton University Press.
Krasner, David. 1997. Resistance, Parody, and Double Consciousness in African American Theatre, 1895–1910. Bloomsburg: Macmillan.
Krasner, David. 2001. „Black Salome. Exoticism, Dance, and Racial Myths“. In African American Performance and Theater History. A Critical Reader, herausgegeben von Harry J. Elam und David Krasner, 192–211. Oxford: Oxford University Press.
Kusser, Astrid. 2013. Körper in Schieflage. Tanzen im Strudel des Black Atlantic um 1900. Bielefeld: transcript.
Laclau, Ernesto und Chantal Mouffe. 2001. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.
Lhamon, W.T. 1998. Raising Cain. Blackface Performance from Jim Crow to Hip Hop. Cambridge: Harvard University Press.
Library of Congress. o.D. „Oh! How She Could Yacki Hacki Wicki Wacki Woo (That’s Love in Honolulu).” Zugriff am 3. Oktober 2020. Link.
Locke, Ralph P. 2009. Musical Exoticism. Images and Reflections. Cambridge: Cambridge University Press.
Lott, Eric 1993. Love and Theft. Blackface Minstrelsy and the American Working Class. New York: Oxford University Press.
Lotz, Rainer. 1997. Black People. Entertainers of African Descent in Europe, and Germany. Bonn: Birgit Lotz.
Maase, Kaspar. 1997. Grenzenloses Vergnügen. Der Aufstieg der Massenkultur, 1850–1970. Frankfurt am Main: Fischer.
McClary, Susan. 1992. Georges Bizet. Carmen. Cambridge: Cambridge University Press.
McClintock, Anne. 1995. Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. New York: Routledge.
Moon, Krystyn. 2005. Yellowface. Creating the Chinese in American Popular Music and Performance, 1850s–1920s. New Brunswick: Rutgers University Press.
Mooney, Jennifer. 2015. Irish Stereotypes in Vaudeville, 1865-1905. New York: Palgrave Macmillan.
Morat, Daniel, Tobias Becker, Kerstin Lange, Johanna Niedbalski, Anne Gnausch und Paul Nolte. 2016. Weltstadtvergnügen. Berlin 1880–1930. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Otte, Marline. 2006. Jewish Identities in German Popular Entertainment, 1890–1933. Cambridge: Cambridge University Press.
Peiss, Kathy. 1986. Cheap Amusements. Working Women and Leisure in Turn-of-the-Century New York. Philadelphia: Temple University.
Radano, Ronald und Philip V. Bohlman. 2000. Music and the Racial Imagination. Chicago: Chicago University Press.
Reckwitz, Andreas. 2006. Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne. Weilerswist: Velbrück.
Reuter, Julia. 2002. Ordnungen des Anderen. Zum Problem des Eigenen in der Soziologie des Fremden. Bielefeld: transcript.
Rogin, Michael. 1996. Blackface, White Noise. Jewish Immigrants in the Hollywood Melting Pot.Berkeley: University of California Press.
Saïd, Edward. 1978. Orientalism. New York: Pantheon.
Samson, Jane. 2005. Race and Empire. Harlow: Pearson Education Limited.
Schultz, Jeffrey D., Kerry L. Haynie, Anne M. McCulloch und Andrew L. Aoki. 2000. Encyclopedia of Minorities in American Politics. Volume 2. Hispanic Americans and Native Americans. Phoenix: Oryx Press.
Smith, Jacob. 2008. Vocal Tracks. Performance and Sound Media. Berkeley: University of California Press.
Snyder, Ted. 1989. The Voice of the City. Vaudeville and Popular Culture in New York. New York: Oxford University Press.
Studlar, Gaylyn. 2011. „Theda Bara. Orientalism, Sexual Anarchy, and the Jewish Star.“ In Flickers of Desire. Movie Stars of the 1910s, herausgegeben von Jennifer M. Bean, 113–36. New Brunswick: Rutgers University Press.
Suisman, David. 2009. Selling Sounds. The Commercial Revolution in American Music. Cambridge: Harvard University Press.
Susman, Warren I. 2003. „The Frontier Thesis and the American Intellectual.“ In Culture as History. The Transformation of American Society in the Twentieth Century, herausgegeben von ders., 27–38. Washington: Smithsonian.
Taylor, Timothy. 2007. Beyond Exoticism. Western Music and the World. Durham: Duke University Press.
The Riverbends Channel. 2012. „A Natural Born Gambler (1916) – Bert Williams Silent Film.“ YouTube. Link.
The Riverbends Channel. 2015. „Fish (1916) – Bert Williams Silent Film.“ YouTube. Link.
Troutman, John W. 2012. Indian Blues. American Indians and the Politics of Music, 1879–1934. Norman: University of Oklahoma Press.
Turner, Frederick J. 1966. The Significance of the Frontier in American History. Ann Arbor: University Microfilms.
UC Santa Barbara Library. o.D.a. „Good-a-bye John.“ UCSB Cylinder Audio Archive. Zugriff am 3. Oktober 2020. Link.
UC Santa Barbara Library. o.D.b. „Silver Bell.“ UCSB Cylinder Audio Archive. Zugriff am 03 Oktober 2020. Link.
UC Santa Barbara Library. o.D.c. „That Lovin‘ Rag.“ UCSB Cylinder Audio Archive. Zugriff am 6. April 2020. Link.
Wicke, Peter. 2001. „Sound-Technologien und Körper-Metamorphosen. Das Populäre in der Musik des 20. Jahrhunderts“. In Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert: Rock- und Popmusik, Band 8, herausgegeben von Peter Wicke, 11–60. Laaber: Laaber.
Williams, Bert. 1918. „The Comic Side of Trouble“. American Magazine 58, 33–34, 58–60. Zugriff am 3. Oktober 2020. Link.
Zitiervorschlag
Just, Steffen. 2021. „Zur Doppelstruktur und Ambivalenz der Differenz: Inszenierungen von Anderen im populären Musiktheater, 1890–1930.“ In Pop – Power – Positions: Globale Beziehungen und populäre Musik, herausgegeben von Anja Brunner und Hannes Liechti (~Vibes – The IASPM D-A-CH Series 1). Berlin: IASPM D-A-CH. Online unter www.vibes-theseries.org/just-musiktheater.
Titelbild: Die US-amerikanischen Musiktheaterstars Joe Weber und Arthur Fields in einem schottischen Bühnenact (ca. 1895-1904) (© Billy Rose Theatre Division, The New York Public Library. „Webeer and Fields“ The New York Public Library Digital Collections. 1895 – 1904. Link)
Abstract (English)
From 1890 until 1930, predating the advent of radio and film musicals, musical theatre dominated the world of European and North American popular music. Stage performers commonly put on masks and costumes to portray a wide range of racially stereotyped stock characters, which I analyse through the postcolonial trope of The Other/Othering. I reconstruct the cultural hegemonies, social tensions, identity and body politics that shaped and critically challenged these colonial fantasies through an investigation of English, German and American musical theatre acts and shows.