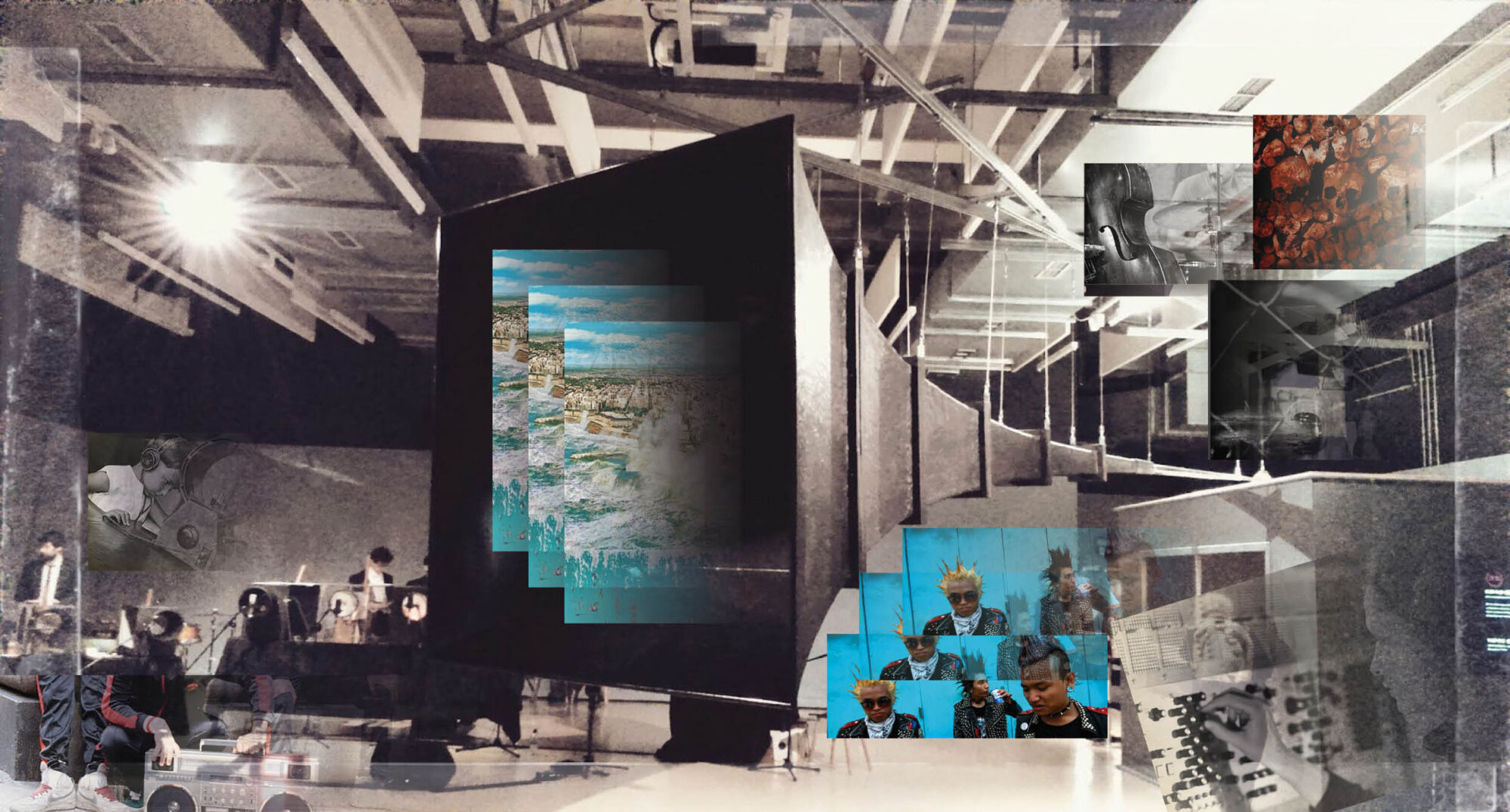The treatment of Turkish music and especially Turkish pop in the Federal Republic of Germany has been characterized by various mechanisms of demarcation since the 1960s – that is, since the arrival of a strong Turkish presence due to the recruitment agreement. In this chapter, we would like to explore the questions of where these mechanisms take effect, by whom they are argued and in what ways, as well as how they have changed over the period from the 1960s to the present. Since demarcation is not a purely musical phenomenon, but has to take related social aspects into account, we will first look at the phenomena of social and cultural demarcation in German society, especially with regard to migrant communities. Subsequently, we pursue a series of core questions concerning Turkish music and its audience, its musical functions and the music market, as well as the respective evaluations of Turkish music in Germany. Answers to our core questions led to a critique of the music-related aspects of German migration policy and the institutional treatment of Turkish music in Germany. One of the biggest problems, from our point of view, which is clearly shown by the phenomenon of self-exclusion, is the lack of discourse, historiographical transmission and structured access to migrant cultural expressions. Using a discourse-analytical approach that draws primarily on statements from politics, academia, journalism and musical practice, this chapter analyses the workings of the mechanism that has excluded Turkish music throughout the decades.
„Migration ist jetzt nicht irgend so eine temporäre Randerscheinung, sondern ein Konstitutiv unserer Gesellschaft, also sehr prägend, sehr wichtig.“
İmran Ayata und Bülent Kullukcu, Kompilatoren der Reihe „Songs of Gastarbeiter“ (İmran Ayata und Bülent Kullukcu, in Ruhland/ Wilczek 2022)
„Wenn ich jetzt hier die ganzen Läden sehe, wo ich für ein Brot neun Euro zahlen muss und ich nur auf Englisch bestellen kann, denke ich mir: Das ist eigentlich die wirkliche Parallelgesellschaft.“
PTK, Rapper aus Berlin-Kreuzberg (PTK, in Kendler 2023: 114)
1. Einführung – soziale und kulturelle Abgrenzungsphänomene in der Gesellschaft
Der Umgang mit türkischer Musik und insbesondere türkischer Popmusik ist in der Bundesrepublik Deutschland seit den 1960er-Jahren, also seit einer starken türkischen Präsenz aufgrund des Anwerbeabkommens, von verschiedenen Abgrenzungsmechanismen geprägt. Den Fragen, wo diese greifen, von wem sie wie argumentiert werden, aber auch wie sie sich im Laufe der Zeit verändern, möchten wir mit diesem Beitrag für den Zeitraum von den 1960er-Jahren bis in die Gegenwart nachgehen. Da es sich bei den musikalischen Grenzziehungen nicht um rein musikalisch zu betrachtende Phänomene handelt, sondern damit verbundene gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen sind, wird zunächst auf soziale und kulturelle Abgrenzungsphänomene in der deutschen Gesellschaft eingegangen, speziell mit Bezug auf migrantische Communitys. Anschließend wird eine Reihe von Kernfragen verfolgt, welche türkische Musik und ihr Publikum, Musikfunktionen und Musikmarkt sowie insbesondere die dabei jeweils erfolgenden Bewertungen türkischer Musik in Deutschland betreffen. Begleitet werden diese Fragen von der Untersuchung vorwiegend musikrelevanter Aspekte deutscher Migrationspolitik.
Die Präsenz türkischer Communitys in Deutschland ist Teil der seit den späten 1950er-Jahren kontinuierlich angestiegenen migrantischen Präsenzen in Deutschland. Im Jahr 2021 lebten in Deutschland 83 Millionen Menschen. Davon verfügten 22,3 Millionen Personen, also mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung, über einen „Migrationshintergrund“ (Statistisches Bundesamt 2022). Diese Daten widerlegen all jene, die jahrzehntelang die Migrationsbewegungen nach Deutschland verleugneten. „Wir wollen und können kein Einwanderungsland sein“, erklärte Bundeskanzler Helmut Schmidt von der SPD im Jahr 1979 (Schmidt in BR24, zit. n. Kodýdková 2018: 19). Noch 1996 beantwortete die Koalitionsregierung aus CDU/CSU und FDP die Frage, ob sich Deutschland als Einwanderungsland begreife, deutlich mit „Nein“ (BR 2010). Erst im Jahr 2015 erkannte mit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel von der CDU eine Regierungschefin Deutschland als Einwanderungsland an, hierin, recht verspätet, der Position der Grünen folgend (dpa 2015). Allerdings bemerkte die SPD-Politikerin Andrea Nahles, Vorstandsleiterin der Bundesagentur für Arbeit, angesichts einer jährlichen Ab- und Weiterwanderung von zwei Dritteln der in Deutschland eingewanderten Menschen aufgrund ungünstiger Rechtslage und einer problematischen deutschen Bürokratie noch im Jahr 2022: „Wir sehen uns offenbar immer noch nicht in letzter Konsequenz als Einwanderungsland“ (Nahles, in Specht 2022: 8). Die aktuellen Debatten hierzu scheinen noch nicht abgeschlossen zu sein.
Ausgehend hiervon, möchten wir verschiedene Beobachtungen zu sozialen und kulturellen Abgrenzungsphänomenen an den Beginn unserer Ausführungen stellen. Der Begriff ‚Abgrenzungsphänomene‘ erscheint uns dabei für unsere Argumentation zuweilen besser geeignet zu sein als der hochpolitisierte Begriff der ‚Parallelgesellschaft‘, der meist von vornherein negativ konnotiert und einseitig ist, weil er diskursiv oft mit Blutrache, Ehrenmorden, Zwangsheirat oder Kopftuchpflicht für Mädchen und Frauen verbunden wird (vgl. Rat für Migration 2014). Diese Art von Argumenten wurde etwa von Thilo Sarrazin in seinem einschlägigen Gespräch mit Frank Berberich in Lettre International (Berberich/Sarrazin 2009) vertreten und war dann Grundlage des darauf aufbauenden Diskurses zum Begriff der Parallelgesellschaft, gespeist von Sarrazins Büchern und entsprechenden Gegenschriften (vgl. Kaube/Kieserling 2022).
Der Diskurs zum Begriff der Parallelgesellschaft ist gegenwärtig weiterhin lebendig. Falko Liecke, CDU-Bezirksstadtrat für Soziales in Berlin, gab zum Beispiel unlängst in der Berliner Zeitung kund, eine „komplette Parallelgesellschaft“ sei „herangewachsen, die mit unseren Staatsorganen, der Polizei und unserem Bildungssystem nichts zu tun hat“ (Liecke, in Hauenstein 2023). Dabei dachte er allerdings nicht an deutsche Reichsbürger*innen, sondern er meinte den migrantisch geprägten Berliner Ortsteil Neukölln.
Der Stadtforscher Stephan Lanz fasst hierzu treffend zusammen, Begriffe wie derjenige der ‚Parallelgesellschaft‘ dienten dazu, „die Ursachen der Absonderung von der Mehrheitsgesellschaft auf die Migrantinnen und Migranten zu schieben. Zum Thema wird die vorgebliche Integrationsunfähigkeit gemacht, nicht jedoch die Integrationsunwilligkeit der Mehrheitsgesellschaft“ (Lanz, in Arın et al. 2005: 643). Tatsächlich assoziiert kaum jemand den Begriff der ‚Parallelgesellschaft‘ mit jenen Teilen der Bevölkerung, die – wie die Reichsbürger*innen – sich bewusst und diskriminierend gegenüber Migrant*innen als Teil der Gesellschaft abgrenzen (vgl. Kaube/Kieserling 2022: 216-239). Hinzu kommen noch weit komplexere Abgrenzungsphänomene wie etwa Fremdabgrenzungen und Selbstabgrenzungen auf beiden Seiten, sowohl auf Seiten dominanzgesellschaftlicher Communitys ebenso wie auf Seiten migrantischer Communitys, was die Komplexität des Begriffsfeldes erhöht.
Wir werden, dort wo notwendig, weil durch den Titel der Tagungspublikation als Bezugspunkt gesetzt, dennoch auf den Begriff der Parallelgesellschaft zurückkommen, ansonsten jedoch eher von Abgrenzungs- oder Ausgrenzungsphänomenen sprechen. Manchmal erscheint es durchaus sinnvoll, den Begriff der ‚Parallelgesellschaft‘ aufzugreifen, denn er lässt sich auch kritisch wenden, wie etwa Kaube/Kieserling provokativ im Klappentext ihres Buches zeigen: „Wenn das islamisch dominierte Viertel in Berlin-Neukölln eine Parallelgesellschaft ist, muss dann nicht auch das Villenviertel im Grunewald so bezeichnet werden?“ (Kaube/Kieserling 2022). Eine ähnliche provokative Wendung, die parteienübergreifend positive Aufnahme fand, vollzog unlängst CDU-Politiker Armin Laschet, gerichtet an die AfD: „Sie haben über Parallelgesellschaften gesprochen, und in der Tat, Sie haben recht, das war eine Parallelgesellschaft: der NSU [Nationalsozialistischer Untergrund], der zehn Jahre mordend durchs Land zog!“ (Laschet, in Matteoni 2023).
Anzeichen für Abgrenzungsbemühungen gegenüber Migrant*innen ließen und lassen sich auch innerhalb unterschiedlicher musikalischer Milieus feststellen. „Keine Ausländer“ ist über lange Zeit hinweg nicht nur ein fester Zusatz bei Wohnungsofferten gewesen (Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 2023: 48), sondern eben auch eine Ablehnungsformel gegenüber migrantischen Gästen in Musiklokalitäten. Manfred Vollmer fotografierte etwa 1974 die Fassade der Diskothek Club 99 in Gelsenkirchen, auf der deutlich lesbar ein Schild prangte mit der Aufschrift: „Für Ausländer Zutritt verboten“ (Vollmer 1998).
Unschwer könnte man jedoch auch sagen, dass angesichts solcher Phänomene wie des Wohnungsbewerbungs- und Lokalitätszutrittsverbotes für Ausländer*innen bis hin zur jahrzehntelangen hartnäckigen politischen Deklaration Deutschlands als angebliches Nicht-Einwanderungsland die deutsche Dominanzgesellschaft sich selbst in der Abgrenzung von den migrantischen Communitys einrichtete. Dies geschah, indem sie den vom Status her ‚nicht-eingewanderten‘, gleichwohl jedoch in Deutschland arbeitenden und lebenden Menschen, mithin sogenannten Gastarbeiter*innen, gesellschaftlichen Zutritt und Teilhabe verweigerte, sie ausgrenzte. Nichts weniger wurde seitens der deutschen Dominanzgesellschaft von den sogenannten Gastarbeiter*innen aus der Türkei erwartet als eine existenzielle Ausblendung ihrer selbst: Sie sollten für minimales Geld und rechtlich kaum geschützt jene unliebsamen und schweren Arbeiten verrichten, für die sich niemand anderes finden ließ und dann über Nacht sowie über das Wochenende in separate Wohngebiete verschwinden (vgl. Gutmair 2023: 27-33). Der Wunsch nach Unsichtbarkeit der Arbeitsmigrant*innen lässt sich bereits in einem Spiegel-Titel aus dem Jahr 1973 finden: „Jeder zweite Berliner wünscht, nichts mit Türken zu tun zu haben, jeder siebte wünscht sie ins separate Wohngebiet“ (Spiegel 1973). Das musste zu einem gewissen Abgrenzungsphänomen führen, welches Bedürfnisse, Rechte und letztlich die Existenzanerkennung von Arbeitsmigrant*innen ausklammert.
Wenn wir vor diesem Hintergrund den Blick nun speziell auf Grenzziehungen und Abgrenzungen in Bezug auf türkische (Pop-)Musik in der Bundesrepublik Deutschland von den 1960er-Jahren bis heute lenken, so ergibt sich eine Reihe von Fragen, denen der vorliegende Beitrag nachgeht:
- Wer hört welche türkische Musik in Deutschland, wo und wozu?
- Welche Rolle spielen Abwertung und Ausschluss türkischer Musik in Deutschland?
- Wie verhalten sich ‚Parallelgesellschaft‘ und musikalischer Parallelmarkt zueinander?
- Inwiefern findet eine Entwertung türkischer Musik im Rahmen von Selbstausgrenzung statt?
Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu türkischer Musik in Deutschland, besonders aber zu türkischer Popmusik, sind noch immer rar. Einen Überblick zur Forschungslage bezüglich türkischer (Pop-)Musik aus der Türkei und aus Deutschland liefern Ramm (2020), Lund (2021) und Lund/Lund (2022). Die historiografische Aufarbeitung zu türkisch-deutschem Film und türkisch-deutscher Literatur (vgl. Neubauer 2011; Alkın 2017) sowie zu türkisch-deutschem Theater (vgl. Boran 2023) ist hier bereits weiter gediehen. Das solitäre Standardwerk für türkische Musik in und aus Deutschland, veröffentlicht 2003 von Martin Greve, konzentriert sich auf die 1980er- und vor allem die 1990er-Jahre (vgl. Greve 2003), nicht jedoch auf die 1960er- und 1970er-Jahre und die Zeit ab den 2000er-Jahren.
Gerade im Vergleich zu anderen kulturellen Äußerungsformen von Türk*innen ist die wissenschaftliche und kuratorische Aufarbeitung türkischer Musik in und aus Deutschland auffallend defizitär. So beinhalten die umfangreichen, periodisch erscheinenden migrationshistorischen Katalogprojekte, die immer wieder anlässlich von Jubiläen des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens von 1961 publiziert wurden (Eryılmaz/Jamin 1998; Kölnischer Kunstverein 2005; Eryılmaz/Lissner 2011), kaum eine Auseinandersetzung mit türkischer Musik im Vergleich zu anderen kulturellen Äußerungsformen. Im umfangreichsten dieser Kataloge (Kölnischer Kunstverein 2005) verfasste ausgerechnet einer der profiliertesten deutschen Popmusiktheoretiker*innen und -kenner*innen, nämlich Diedrich Diederichsen, zwar einen Artikel zur Repräsentation von Türk*innen im deutschen Film, nicht aber zu türkischer Musik. Hier fällt die Leerstelle besonders deutlich ins Auge. Zu den Gründen dafür geben Ramm (2020), Lund (2021) und Lund/Lund (2022) Aufschluss, wenngleich zur historiografischen Ausblendung von migrantischen Musiken in Deutschland noch weitere Untersuchungen notwendig erscheinen (vgl. Ayata/Kullukcu 2022).
Aufgrund der zu geringen musikhistoriografischen Aufarbeitung migrantischer Musiken in Deutschland stützen wir uns zur Bearbeitung der oben gestellten Fragen in erster Linie auf einen von Foucault hergeleiteten, breiten diskursanalytischen Ansatz (vgl. Jäger 2012), der vor allem Aussagen aus Politik, Wissenschaft, Journalismus und Musikpraxis in unterschiedlichen massenmedialen Formaten kritisch auswertet.
Dieser Ansatz wird ergänzt um eine experimentelle, qualitativ-reaktive Hörumfrage (Brennen 2021) zur Prüfung der Akzeptanz türkischer Popmusik bei einem nicht-türkischen Publikum in Deutschland. Hinzu kommt die museologische Beobachtung (vgl. Janelli/Hammacher 2008) der ersten Museumsausstellung zu türkischer Musik in Deutschland, da eine öffentliche Ausstellung auch als institutioneller diskursiver Beitrag zu verstehen ist.
2. Wer hört welche türkische Musik in Deutschland, wo und wozu?
Die Kulturanthropologin und Islamwissenschaftlerin Maria Wurm schreibt:
„Der türkischen Musik in Deutschland wird mit großer Skepsis begegnet. So spricht Rita Süßmuth [sic], ehemalige Bundestagspräsidentin und Vorsitzende der im Jahre 2000 von der Bundesregierung eingesetzten Einwanderungskommission, in einem Interview mit der Tageszeitung davon, dass die Entstehung ethnisch ausgerichteter […] Diskotheken vermieden werden müsse. Dies muss überraschen, ist doch über türkische Diskotheken in Deutschland so gut wie nichts bekannt, und auch nichts darüber, was eine Vorliebe für türkische Musik über die Einstellung zu einem Leben in Deutschland oder gar zum deutschen Staat aussagt. Vorlieben für türkische Musik werden vielfach als ein Festhalten an der Herkunftskultur und ein Traditionsrelikt verstanden und als solche als integrationshemmend bewertet“ (Wurm 2006: 10, Kursivschreibung i. O.).
Ähnlich beobachtet auch die Theologin Handan Aksünger-Kizil, der Vermittlung von Werten der Herkunftsgesellschaft werde eine die Integration hemmende – mitunter rückständige – Wirkung zugeschrieben (Aksünger 2013: 43).
Rita Süssmuth war 2000 bis 2001 Vorsitzende der von der deutschen Bundesregierung beauftragten Unabhängigen Kommission Zuwanderung und stand, gerade auch in ihren eigenen Parteireihen, in der Kritik für zu migrant*innenfreundliche Positionen. Immerhin konterte sie im besagten Interview den Begriff der gesellschaftlichen „Belastungsgrenze“, bezogen auf Migration, mit dem Begriff der „Bereicherung“. Klar blieb allerdings auch unter ihrem Kommissionsvorsitz, dass die „Entstehung von Parallelgesellschaften“ verhindert werden müsse (Süssmuth, in Gaus 2000: 3). Mit der befürchteten Entstehung von ‚Parallelgesellschaften‘, die eine Spaltung der deutschen Gesellschaft impliziert, sah auch sie die „Integrationsgrenze“ erreicht (ebd.). Dies verband sie mit musikalischer Besorgnis, tendenziell in Richtung einer Verhinderung der Schnittstellen von Orten, migrantischen Communitys und ihren Musiken: „rein ethnisch ausgerichtete Diskotheken“ galt es zu vermeiden (ebd.).
Diese Order galt bemerkenswerterweise jedoch nicht für alle migrantischen Communitys und ihre Musiken gleichermaßen, sie besaß weder für die tatsächlich ethnisch ausgerichteten Diskotheken der U.S.-Streitkräfte wie den Black Soldiers-Clubs noch für z.B. italienisch geprägte Discos Gültigkeit. Der Musikstil Italo-Disco war im Gegenteil in den 1980er-Jahren einer der beliebtesten Disco-Sounds in jeglichen Diskotheken, gleichviel ob diese nun italienisch geprägt oder anderweitig orientiert waren.
Doch seit wann existieren in Deutschland überhaupt türkische Diskotheken, über die „so gut wie nichts“ bekannt ist? Tatsächlich gab es in den 1990er-Jahren eine kurzzeitige Welle türkischer Diskotheken in Deutschland. Der Musikethnologe Martin Greve schreibt dazu:
„Semih Yıldırım etwa, eigentlich gelernter Schweißer, betreibt seit einigen Jahren mit dem ‚Efendi‘ den wohl bekanntesten Hochzeitssalon Duisburgs. Als kurz darauf [um 1993] türkische pop müzik in Mode kam, veranstaltete er in seinem Hochzeitssalon die ersten türkischen Pop-Parties [sic] der Stadt und benannte das Etablissement schließlich ganz in ‚Disko Andromeda‘ um. Als die Welle abklang, wurde das ‚Efendi‘ wieder zum Hochzeitssalon, wo neben einzelnen Discoabenden auch Konzerte und Frauen-Matineen stattfinden. Die Liste der Gastmusiker reicht von der deutsch-türkischen Rapgruppe Cartel über arabesk-Sänger wie Müslüm Gürses, den kurdischen Liedermacher Ivan Perwer, alevitische Sänger wie Arif Sağ oder Musa Eroğlu bis hin zum Popstar Burak Kut“ (Greve 2003: 130, Kursivschreibung u. Anführungszeichen i. O.).
Die Gründungswelle war so stark, dass sie sogar zu dem Versuch führte, ein türkisches Gazino, eine Art Musikrestaurant oder Café chantant, prominent im Zentrum von West-Berlin zu platzieren. Dieser Idee war jedoch kein Erfolg beschieden. Greve schreibt dazu:
„Der kühne Versuch, in Berlin im Oktober 1994 direkt am teuren Kurfürstendamm ein großes […] Restaurant (‚Kudambah‘) zu betreiben, mit einem festen Ensemble aus sieben Begleitmusikern, sowie jeden Monat mit drei Sängern aus der Türkei, scheiterte bereits nach zwei Monaten“ (Greve 2003: 124, runde Klammern u. Anführungszeichen i. O.; vgl. auch Lorenz 2021: 24).
Erfolgreicher verlief laut Gonca Mucuk das Aufkommen der türkischen Discoszene im Ruhrgebiet in den 1990er-Jahren. Auch Mucuk koppelt dieses Aufkommen an die „westlicher“ werdende türkische pop müzik, verbunden „mit der Tatsache, dass man als ‚Kanake‘ ohnehin so gut wie nie in eine ‚deutsche‘ Diskothek kam. Das […] führte dazu, dass sich Anfang der 1990er Jahre eine neue Feierkultur in Deutschland – und von hier ausgehend in Europa – etablierte. Die Ära der türkischen Diskotheken […] war eingeläutet“ (Mucuk 2011: 232, Anführungszeichen i. O.).[1] Mucuk stellt ferner heraus, dass „[…] zu deren Stammgästen im Verlauf der 1990er Jahre nicht nur Deutsch-Türken, sondern auch immer mehr Deutsche gehören“ (ebd.: 234). Sie führt das Aufkommen der türkischen Diskoszene auch und vor allem als Reaktion auf Exklusionserfahrungen in deutschen Diskotheken zurück (worüber Süssmuth, siehe oben, kein Wort verliert).
Ein Twist, der Süssmuth völlig entgangen zu sein scheint, besteht darin, dass die türkischen Diskotheken ihrerseits offenbar inklusiv gegenüber einem deutschen Publikum agierten, welches seinerseits von Musik globaler Pop-Stars türkischer Herkunft wie Tarkan angezogen wurde. Die von Süssmuth anvisierte Vermeidung ethnisch ausgerichteter Diskotheken würde also geradezu verhindern und konterkarieren, was von Seiten der damaligen Bundesregierung angestrebt wurde: Integration. Dass sich Menschen nicht-türkischer Herkunft in Deutschland für diverse kulturelle Erfahrungen interessieren könnten, fand in Süssmuths Aussagen keine Beachtung.
Allerdings bleibt zu berücksichtigen, dass die letztlich wenigen öffentlich zugänglichen Institutionen türkischen kulturellen Lebens in Deutschland, wie die Gazinos, die Diskotheken oder die Videoverleihe, im Laufe der 1990er-Jahren wiederum schlossen. Dies lässt sich insbesondere mit dem Aufkommen und der Verbreitung des damals neuen Satellitenfernsehens begründen, das die Art und Weise veränderte, wie Film und Musik zugänglich waren und konsumiert wurden. Das Satellitenfernsehen führte zu einer Privatisierung und Individualisierung des Musik- und Filmkonsums in heimischen Wohnungen. Zum Zeitpunkt des Süssmuth-Interviews, also um das Jahr 2000, war keine nennenswerte Anzahl türkischer Diskotheken mehr in Deutschland zu verzeichnen.
Wie ist die Situation im medialen Diskurs zu Beginn der 2000er-Jahre? Maria Wurm fasst hierzu zusammen:
„Breiten Raum nimmt hier ein, inwiefern sich Jugendliche von ‚unerwünschten‘ Inhalten oder Vorbildern beeinflussen lassen könnten. Dies dürfte eine der größten Befürchtungen einer ‚deutschen Mehrheitsöffentlichkeit‘ sein und erheblich zu dem Misstrauen beitragen, das türkischer Musik in Deutschland entgegengebracht wird“ (Wurm 2006: 11, Anführungszeichen i. O.).
Musik soll hier politisch-edukativ haftbar gemacht werden, als negativer Sozialisationskatalysator. Wurm verfolgt diese Idee nicht historisch, obgleich hier herkömmliche Stereotypen aus der angeblich jugendverderbenden Rock‘n‘Roll-Verteufelung mitschwingen (vgl. Mattern 2023). Vielmehr bringt sie eine Kritik ins Spiel, die darin liegt, überhaupt keine Wendung zum Positiven zuzulassen:
„Es wird nicht die Möglichkeit bedacht, dass an ausgewählten Aspekten einer Herkunftskultur festgehalten werden kann oder dass sie neu aufgegriffen, vielleicht auch abgewandelt werden können, und dass dies eine aktive und konstruktive Form der Verortung im Migrationskontext und der Eingliederung und harmonischen Einfügung in das deutsche Leben ist“ (Wurm 2006: 10).
Folgt man zudem Achille Mbembe, so lässt sich festhalten, dass die durch Misstrauen und Befürchtungen begleitete Entwertung migrantischer Kulturen durchaus Züge einer (inner-)kolonialen Politik aufweist, bei der die systematische Entwertung der kolonisierten Kultur einerseits der Legitimation der Beherrschung und Ausbeutung der Kolonisierten und andererseits der Entwertung der Kolonisierten selbst dient, die daran ihre Minderwertigkeit und Rechtlosigkeit einsehen können (vgl. Mbembe 2015).
Wenden wir uns erneut den von Wurm beobachteten „‚unerwünschten‘ Inhalten oder Vorbildern“ zu, welche die türkische Musik transportiere. Was ist die in Deutschland überwiegend undifferenziert gesehene türkische Musik? Sie stellt ein sehr vielfältiges, polykulturelles Phänomen dar, das historisch, praxisbezogen und stilistisch aus dem Osmanischen Reich und dessen Verwestlichungstendenzen erwachsen ist. Diese Tendenzen wurden im Rahmen der Kulturrevolution Atatürks erweitert, verstärkt und türkifiziert (vgl. Bartsch 2011). Die daraus entstandenen Musiken weisen einen Hybridcharakter auf. In Langzeitperspektive gesehen, schließt der Hybridcharakter neben östlichen Elementen, insbesondere anatolischen, arabischen, persischen, zentralasiatischen und indischen, gleichermaßen westliche Elemente aus Regionen des Balkans, des mediterranen Raumes, sowie des anglo-amerikanischen Raumes ein (vgl. Lund 2020). Dabei kann es zu sehr unterschiedlichen und sehr vielfältigen Hybridbildungen kommen, die Musik aus der Türkei auszeichnen (vgl. Greve 2017).
Der Anadolu Pop der 1960er- bis 1980er-Jahre oder der türkische Hip-Hop der 1990er-Jahre sind Beispiele für hybride musikalische Praxen, die teilweise sehr nah an Konventionen westlicher Pop-Musik herangeführt werden. Dafür lässt sich ein Hörbeispiel aus dem Anadolu Pop anbringen: Mazhar ve Fuats „Nerde Hani“ aus dem Jahr 1973.[2] Dieses demonstriert exemplarisch den Top Ten-Mainstream türkischer Popmusik der 1970er-Jahre. Es handelt sich um eine sanfte, melodiöse Folkpop-Musik, durchaus leicht eingängig für westliche Ohren. Wir nutzten dieses Stück im privaten Umfeld als Testmusik um 2006, also ca. zehn Jahre vor dem (Neo-)Anadolu Pop-Revival der späten 2010er-Jahre – mit sehr positivem Akzeptanzfeedback bei Menschen nicht-türkischer Herkunft in Deutschland. Das Entscheidende dabei war: die Musik wurde den Proband*innen ohne Kenntnis türkischer Musik komplett anonym vor- bzw. als Datei zugespielt, ohne jegliche Paratexte, sodass keine Voreinstellungen oder Erwartungen das Hören beeinflussen konnten.
Dass türkische Pop-Musik mitunter sehr nah an ‚westlichem‘ Pop liegt, wird jedoch oft von nicht-türkischer Seite aufgrund eines bewussten oder unbewussten Otherings türkischer Musik ausgeblendet. Dieses Othering setzt etwa jegliche populäre türkische Pop-Musik vorurteilshaft mit Makam-Musik gleich, die tonal und kompositorisch grundsätzlich anders als westliche Musik gebaut ist, auch wenn, wie Greve mit seinem Buch Makamsız [wörtl.: „ohne Makam“] sehr deutlich gezeigt hat, die Entwicklung populärer türkischer Musiken sich seit Jahrzehnten von makambasierter Musik entfernt (vgl. Greve 2017). Auch Mazhar ve Fuats „Nerde Hani“ ist, wie Anadolu Pop zumeist, bereits makam-frei.
Wer hörte in Deutschland in den 1960er- bis 1980er-Jahren überhaupt welche Formen türkischer Musik? Türkische Arbeitsmigrant*innen der ersten Generation begannen in den 1960er-Jahren Almanya Türküleri, sogenannte Deutschlandlieder, zu hören. Dies sind Lieder von Migrant*innen, die in der Aşık-Tradition der Wandersänger*innen in Deutschland entstanden sind. Hier handelt es sich um eine inhaltliche Parallelentwicklung zum Chanson Immigrée bzw. dem Chanson-Banlieue in Frankreich. Diese begannen in den 1950er-Jahren als Chanson de Là-Bas, als herkunftsorientierte migrantische Lieder, und reflektierten inhaltlich das migrantische Leben in seinen Problematiken (vgl. Daadouch 2018).
Ein Hörbeispiel für die genannten Deutschlandlieder stammt vom wohl ersten Aşık in Deutschland, Metin Türköz, und trägt den Titel „Meister İşçi Kavgası“ (o.D., verm. 1970er-Jahre). Es behandelt zweisprachig, auf Deutsch und auf Türkisch, einen rassistisch geprägten alltäglichen Arbeitskonflikt zwischen einem Schmähworte austeilenden deutschen Meister und einem davon betroffenen türkischen Arbeiter, der sich seinerseits auf Türkisch über den Meister lustig macht. Auf diese Art reflektiert Türköz in typischer Manier eines Almanya Türküleri die spezifische Situation der Arbeitsmigrant*innen in Deutschland (vgl. Gutmair 2023: 80-82).
Der Turkologe Robert Anhegger führt aus, dass türkische Musik insbesondere von den Teilen der eingewanderten türkischen Bevölkerung gehört wird, „die ihr überkommenes Leben auch unter den ‚Ungläubigen‘ weiterführen“ (Anhegger 1982: 18). Ein Lied etwa besingt „die Heimat, die Dörfer [, die …] hierher verpflanzt [sind].“ Entsprechend heißt es in einem Gedicht von Orkan M. Ariburnu: „Mitten in Deutschland ein Anatolien“ (ebd.). Türkische Musik dient hier der Abgrenzung gegenüber der Fremde, der Rück-Verheimatung, als Schutz und als Verankerung.
Genutzt werden hierzu neben Aşık-Musik und vernakulären Regionalstilen insbesondere auch Arabesk-Musik und die sehr populäre türkische Kunstmusik, Türk Sanat Müziği, sowie in den 1980er-Jahren Disko Folk. Dies sind allesamt Musiken, welche tendenziell eher anatolische, arabische oder post-osmanische Seiten der Identität der migrierten türkischen Landbevölkerung musikalisch ansprechen und repräsentieren.
Die genannten Musiken betreffen jedoch nur einen Ausschnitt einer sozial viel differenzierteren türkischen Gesellschaft, nämlich den Ausschnitt einer ruralwirtschaftlich geprägten und ansonsten meist ungelernten Landbevölkerung. Und sie betreffen nur einen Ausschnitt (Aşık-Tradition, vernakuläre Regionalstile, Arabesk, Türk Sanat Müziği, Disko Folk) einer musikalisch ausdifferenzierteren türkischen Musik. Urbane Anadolu Popmusik etwa, wie jene oben erwähnte von Mazhar ve Fuat, kommt bei dem erwähnten migrantischen Ausschnitt der türkischen Gesellschaft praktisch nicht vor.
Warum haben wir als Teil der deutschen Dominanzgesellschaft – abseits folklorisierender Begegnungsfeste oder aktivistischer Ansätze (vgl. Lund/Lund 2022: 71) sowie des türkisch-deutschen Hip-Hops – jahrzehntelang so gut wie nichts über die musikalisch vielgestaltige türkische Musik erfahren bzw. erfahren können? Diese Frage führt zur Bewertung türkischer Musik in deutschen Massenmedien und zu Ausschlüssen als Form der Abgrenzung.
3. Welche Rolle spielen Abwertung und Ausschluss türkischer Musik in Deutschland?
Der Rundfunkjournalist Barry Graves von RIAS Berlin fasste seine Beobachtungen zur Situation türkischer Musik in Deutschland im Jahr 1982 in einem Ausschnitt aus „Berlinale Meets“ zu Cem Kayas Film Aşk, Mark ve Ölüm wie folgt zusammen:
„Türkische Musik, egal ob Folklore, Klassik oder Pop, ist in den Rundfunkanstalten auf den Einsatz im Rahmen der türkischen Sendungen beschränkt, von denen es nicht sehr viele gibt. Hiesige Diskjockeys oder Programmierer beklagen gerne die angeblich geringe Qualität der Produktionen im Pop-Sektor und bei der Klassik die schnelle Ermüdung beim Publikum“ (Graves 1982).
Im Anschluss verweist Graves auf inklusive Potenziale, die jedoch ungenutzt bleiben:
„Es wäre doch überhaupt kein Problem, in sogenannten ‚Bunten Abenden‘, Quizshows, Veranstaltungen jeder Art, türkische Ensembles, türkische Solisten auftreten zu lassen, um Deutsche und Türken über den Umweg der Kultur ein bisschen näher zu bringen. So dass die Leute einfach sagen: ‚Mensch, das ist ja auch interessant, die sind uns nicht mehr fremd. Und die Ajda Pekkan, die Du den ganzen Tag da in Deiner Wohnung nebenan spielst, die hab‘ ich neulich auch im Fernsehen gesehen. Die sieht ja toll aus und die kann ja prima singen.‘ Das passiert leider nicht“ (ebd.).
Graves‘ schlussfolgernder Kernsatz lautet: „Da haben die Medien ganz stark versagt. Da ist nichts unternommen worden in all den Jahren […]“ (ebd.), um türkische Musik generell, aber eben auch in ihrer stilistischen Vielfalt medial zu präsentieren. Dieser Satz behält Gültigkeit, zumindest bis zur einsetzenden Beliebtheit von (Neo-)Anadolu Pop in den späten 2010er-Jahren (Lund/Lund 2022). Manche, wie Regisseur Cem Kaya, sehen Graves Beobachtungen allerdings selbst im Jahr 2022 weiterhin bestätigt:
„Vor zwei Jahren war ich in Köln, da ist Tarkan aufgetreten, der in der türkischen Community und weltweit ein Superstar ist. Die riesige Lanxess Arena war voll bis zum Anschlag, es gab lange Schlangen vor der Tür. Aber es war nicht ein Deutscher da, und erst recht keine deutsche Presse. Ich werde seit meinem Film immer wieder gefragt: Warum wurden diese tollen türkischen Musiker damals eigentlich nie in eine deutsche Fernsehsendung eingeladen? Daran hat sich gar nicht so viel geändert. Warum war denn kein einziger Journalist auf dem Tarkan-Konzert in Köln? Das mediale Desinteresse ist immer noch groß“ (Kaya, in Bax 2022).
In der Tat wurde türkische Musik von den deutschen Radio- und TV-Medien, dem Musikvertrieb, den Musiklokalitäten und den Popmusikfestivals über Jahrzehnte hinweg ignoriert, quasi unsichtbar und unhörbar gemacht (Lund 2021; Lund/Lund 2022). Mit der Ausnahme von kurzen TV-Sendungen für Migrant*innen (in deren entsprechenden Sprachen) wie „Ihre Heimat, unsere Heimat“, „Nachbarn in Europa“ und „Babylon“ (Brake 2022) oder Berichten zu interkulturellen Begegnungsfesten war in deutschen Medien zu musikalischen und kulturellen Aktivitäten türkischer Migrant*innen in der Zeit vor türkisch-deutschem Hip-Hop fast nichts zu sehen oder zu hören. Selbst letzterer konnte sich erst in den 2010er-Jahren erfolgreich in die Charts vorkämpfen. Geradezu absurd muten diesbezüglich die Begründungen der Verantwortlichen an. Der Musiker und Autor Nedim Hazar notiert: „Die deutschen Radiomacher führen an, türkische Musik klinge unangenehm für deutsche Ohren, die befremdlichen Töne könnten zum Beispiel beim Autofahren zu Konzentrationsstörungen führen“ (Hazar 1998: 287).
Hazar führt außerdem das bereits erwähnte, Ende der 1990er-Jahre aufkommende Satellitenfernsehen als einen weiteren Grund für die mediale Unsichtbarkeit türkischer Musiken an:
„Auf diese Weise wurde dann auch die deutsche Öffentlichkeit entlastet, die sich bis dahin ohnehin nicht weiter für Fragen der Kultur und der Kunst der türkischen Migranten interessiert hatte. Dies war der Beginn der kulturellen Ghettoisierung, die später durch das Aufkommen des Fernsehkanals TRT-International und der per Satellitenantenne zu empfangenden weiteren türkischen Fernsehprogramme verstärkt wurde. Zwei Millionen Gebührenzahler verzichteten auf diese Weise freiwillig auf Rechte, die ihnen eigentlich durch die deutschen Radio- und Fernsehanstalten gewährt werden müssen“ (ebd.: 292; vgl. auch Brake 2022).
Jörg Becker thematisiert letzteren Aspekt noch deutlicher. Laut ihm hat die Gebühreneinzugszentrale GEZ zwischen 1960 und 2007 rund 4,8 Milliarden Euro Rundfunkgebühren von Migrant*innen eingenommen:
„Gemessen an den […] 4,8 Milliarden Euro haben migrantische Rundfunkempfänger kaum eine Gegenleistung in Form von für sie spezifischen Angeboten erhalten (spezifische Themen, Sendeformate, Sendezeiten, Spartenkanäle, Musik, Filme und/oder muttersprachliche Angebote)“ (Becker 2011: 11).
Die Mechanismen des Ausschlusses sind auch in anderen Segmenten des deutschen Musikmarktes zu beobachten. Selbst Akteur*innen des kommerziellen Musikmarktes sahen das Potenzial türkischer Musik sehr lange nicht oder wollten es nicht sehen. Rassismus scheint das kapitalistische Interesse überschattet zu haben (vgl. Lund 2021; Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 2023: 54). Deutsche Plattenfirmen wie Ariola, Polydor, Phonogram oder Bellaphon, aber auch mediale Musikformate wie Radio- und Fernsehhitparaden, die sich angeblich der bestverkauften und daher beliebtesten Musik widmeten, ignorierten über Jahrzehnte jede Art von türkischer Musik in Deutschland sowie das Publikum und die Märkte dafür fast vollständig (Güngör/Loh 2019: 31 und 33; vgl. auch Reier 2020; Lund 2021). Dies geschah, obgleich türkische Musiklabels wie Türküola, Uzelli und Minareci, die in Köln, Frankfurt oder München angesiedelt waren, Millionenumsätze mit ihrer Musik erwirtschafteten und zuweilen höhere Absatzzahlen mit ihren Plattenveröffentlichungen als parallel veröffentlichte Top-Ten-Hitparadenmusik generieren konnten (vgl. İlgiç/Pilcz 2021; Genzken 2021; Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 2023: 54). Das heißt: wäre tatsächlich, wie behauptet, die absatzstärkste Musik in den Fernseh- und Radiohitparaden vertreten, hätte türkische Musik darin präsent sein müssen. Denn
„mit zwölf goldenen Schallplatten ausgezeichnet und Hunderttausenden verkauften Tonträgern übertraf Özkasap die Verkaufszahlen von Stars wie Vicky Leandros oder Katja Ebstein. Leandros‘ Hit ‚Theo, wir fahr‘n nach Lodz‘ von 1974 etwa verkaufte sich 400.000-mal, Yüksel Özkasaps Album ‚Beyaz Atlı‘, das nur ein Jahr später erschien, erreichte doppelt so hohe Verkaufszahlen. Im Radio wurde sie trotzdem nicht gespielt und auch nicht in die ZDF-Hitparade eingeladen“ (Genzken 2021).
An dieser Stelle wird der absichtsvolle, diskriminierende Ausschluss türkischer Musik aus musikindustriellen Strukturen und damit auch aus der Öffentlichkeit sehr deutlich.
Auch in der musikalischen Bildungslandschaft Deutschlands regiert seit Jahrzehnten der Ausschluss. Türkische Musik ist an europäischen Musikuniversitäten, Hochschulen oder Akademien kaum repräsentiert, türkische Musikinstrumente werden dort ebenso selten unterrichtet wie an Musikschulen, wie auch Martin Greve noch unlängst feststellen musste: „Until recently only European music academies remained institutions which completely blocked the integration of […] Turkish music“ (Greve 2017: 51). Dies geschah wohl vor allem deshalb, weil man türkische Musik nicht als ‚europäisch‘ einstufte, ungeachtet der Europäisierungen und musikalischen Hybridsierungen, welche die Sultane im 19. Jahrhundert mit der Berufung Gaetano Donizettis an den Hof zur Leitung des Palastorchesters anstießen (vgl. ebd.: 192).
Der türkische Staat seinerseits stellte sich kaum hinter türkische Musik. Die kemalistische Förderung einer türkischen Oper ging einher mit Abwertungs- und Ausschlussmechanismen osmanischer bzw. post-osmanischer Musiken. Das reichte vom jahrzehntelangen Verbot religiöser Musik, der zeitweiligen Radioverbannung osmanisch-arabischer Musik, bis hin zum Verbot kurdischer Musik oder der politischen Verbannung von Musiker*innen des Anadolu Pop durch das Militär in der Folge des Militärputsches von 1980. Immer wieder also wurden türkische Musiken in der Türkei staatsseitig diskreditiert, was eine positive, staatsgestützte Identifikation mit in der Bevölkerung beliebten Musikstilen erschwerte (vgl. ebd.).
Zu den Einrichtungen mit Bildungsauftrag in Deutschland zählen nicht nur akademische Institutionen, sondern auch Museen. Wurde türkische Musik von musealen deutschen Institutionen repräsentiert, und wenn ja, wie? Eine Ausstellung zu türkischer Musik, speziell türkischer Popmusik, vor 2021 in Deutschland ließ sich nicht recherchieren. Manchmal enthielten allerdings Ausstellungen zu anderen Themen auch Sektionen zu türkischer Musik in und aus Deutschland, wie etwa die Foto-Ausstellung „Bizim Berlin 89/90. Fotografien von Ergun Çağatay“ (2018) im Märkischen Museum Berlin. Sie enthielt eine gut ausgebaute Sektion zu türkisch-deutschem Hip-Hop aus Berlin. Im Titel der Ausstellung war davon allerdings nichts zu lesen (vgl. Märkisches Museum Berlin 2018).
Ähnlich verhielt es sich mit der Überblicksausstellung „Hits & Hymnen. Klang der Zeitgeschichte“ zum Verhältnis von Musik und Politik. Sie fand 2021 in der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn statt und enthielt Sektionen zu migrantischer Musik, u.a. auch zur Entstehung von Hip-Hop als migrantischer Musik, wobei die türkische Beteiligung in einer kleinen Sektion hervorgehoben wurde (vgl. Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn 2021). Nedim Hazar fasst zusammen: „In der Bonner Ausstellung ‚Hits und Hymnen‘ […] werden erstmals neben Udo Lindenberg und Nena auch Yüksel Özkasap und Metin Türköz ausgestellt“ (Hazar, in Genzken 2021).
Die erste und bislang einzige spezifische Ausstellung stellte „Gurbet Şarkıları. Lieder aus der Fremde. Musik und Zugehörigkeit zwischen der Türkei und Deutschland (1961–2021)“ dar (vgl. Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz 2021). Sie ist den bereits erwähnten Almanya Türküleri gewidmet, Liedern türkischer Migrant*innen, die in Deutschland entstanden sind und das Leben in Deutschland behandeln.
Verantwortet wurde die Ausstellung vom Museum für Islamische Kunst – Staatliche Museen zu Berlin (SMB) im Pergamonmuseum, das Teil der größten und mächtigsten deutschen Kulturinstitution, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist. Mit dem Pergamonmuseum fand sie zugleich in einem der prestigeträchtigsten deutschen Museen statt, was ihr per se einen besonders gewichtigen und repräsentativen Charakter verlieh. Der kurze Eintrag auf der Webseite sowie die digitale Präsenz der Ausstellung enthalten kaum Informationen zu den Kooperationspartner*innen, auch zum kuratorischen Team ist hier nichts zu erfahren (vgl. ebd.).
Diese Informationsarmut begleitet die Ausstellung auf verschiedenen Ebenen: Nicht nur, dass sich kein Nachhall in Form von Presse-Rezensionen finden lässt, auch der konkrete Ausstellungsort im verzweigten Gebäudekomplex auf der Berliner Museumsinsel war weder im Internet noch im Gebäude selbst kommuniziert. Es gab keinerlei Leitsystem für die Ausstellung, was die Basisstandards für eine Ausstellungspräsenz nicht erfüllt (vgl. Uebele 2006) – und umso wichtiger gewesen wäre, als sich die Ausstellung in einem kleinen, eher abgelegenen Lab-Raum befand. Im Museumsshop gab es weder eine Publikation noch irgendeine andere Form von Merchandise oder thematische Literatur zur Ausstellung, eine Situation, die somit nicht den Basisstandards für Marketing von Museen und Managing von Museumsshops entspricht (vgl. Museum Store Association 2015).
Gezeigt wurde die Musikausstellung als Sonderausstellung des Museums für Islamische Kunst. Diese Einordnung türkischer Musik in die islamische Kunst kann als ein Othering der Musik gelesen werden, zumal der Komplex der SMB auch eine Einordnung unter ein anderes Museumsdach erlaubt hätte: Die Ausstellung wird durch das Framing tendenziell enteuropäisiert, orientalisiert und islamisiert – sie wird also aus europäisch-deutscher Sicht fremd gemacht, was dem Konzept des Otherings entspricht (vgl. Siouti et al. 2022: 7-30). Dies steht jedoch den musikhistorischen Entwicklungen entgegen. Denn türkische Musik ist ab der Republikgründung 1923, zumal aufgrund der kemalistischen, gezielt anti-religiösen Musikpolitik, eindeutig überwiegend säkular (Tas 2014). Dennoch wird sie im Museum für Islamische Kunst, also unter einem religiösen Vorzeichen, ausgestellt. Die Ausstellung selbst bietet allerdings kein einziges Beispiel für islamische türkische Pop-Musik – und das, obwohl der türkisch-deutsche Rap recht früh, bereits in den 1990er-Jahren, zum Beispiel mit der Formation Sert Müslümanlar eine erfolgreiche islamische Variante hervorgebrachte. Auch über das beliebte Yeşil Pop (Green Pop-)Genre, also islamische Pop-Musik generell, erfahren Ausstellungsbesuchende nichts. Das Genre und die türkischen Beteiligungen daran werden nirgendwo erwähnt.
Der offizielle Anspruch dieser Ausstellung zum 60. Jahrestag des Migrationsabkommens beider Länder lautete:
„Die Ausstellung macht unterschiedliche Perspektiven der sogenannten Gastarbeiter*innen und nachfolgender Generationen sichtbar, indem sie sich dem Verhältnis zwischen Musik, individuellen Biografien und gesellschaftlicher Verortung widmet“ (Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz 2021).
Dieses Versprechen wird allerdings konterkariert durch die finale Präsentation und ihr institutionelles Framing, das türkische (Pop-)Musik wiederum exkludiert, marginalisiert und invisibilisiert und auf diese Weise Auskunft gibt über ihre gesellschaftliche Verortung und ihren Wert, der ihr seitens der Staatlichen Museen zu Berlin/Preußischer Kulturbesitz zugeschrieben wird.
Welche Instanz letztlich hierfür Verantwortung trägt, lässt sich dem Kontext der Ausstellung nicht entnehmen. Da der institutionelle Kontext derart großer und mächtiger Gebilde wie der Staatlichen Museen zu Berlin/Preußischer Kulturbesitz seine eigenen Dynamiken entwickeln kann (vgl. Wissenschaftsrat 2020a; 2020b), ist durchaus nicht auszuschließen, dass die Kurator*innen, deren Namen auf der Webseite zur Ausstellung nicht genannt werden, möglicherweise andere Ideen zum Framing der Ausstellung hatten. Dafür würde sprechen, dass etwa die Ausstellungspodcasts und das zentrale Ausstellungsvideo von Mirza Odabaşı, „Sounds aus der Seele – Musik zwischen Almanya und Deutschland“[3], diskursiv andere Spuren legen, indem dort anhand von Zeitzeug*inneninterviews sensibel nach einer Geschichte der türkisch-deutschen Musik, ihrer Rezeption und Wertigkeit gefragt wird.
4. Wie verhalten sich Parallelgesellschaft und musikalischer Parallelmarkt zueinander?
Wie reagierte die türkische Musik-Szene in Deutschland auf ihre jahrzehntelange Abwertung und ihren Ausschluss aus Medien und Musikmarkt? Gerade diese Prozesse führten zur Etablierung eines musikalischen Parallelmarktes. Nedim Hazar schreibt hierzu 1998:
„Unsere mehr als 35-jährige Anwesenheit fand und findet – mit einigen wenigen Ausnahmen – keinerlei Niederschlag in der Musik [im Deutschland der Dominanzgesellschaft]. Die in Deutschland von Türken produzierte Musik findet keinen Eingang in den allgemeinen Markt. Ja man muss sogar von einem zweiten, parallel existierenden Markt sprechen“ (Hazar 1998: 287).
Türkische Labels in Deutschland produzierten und verkauften Millionen an Tonträgern mit türkischer Musik aus Deutschland und der Türkei. Da die Labels aus strukturellem und institutionellem Rassismus heraus (vgl. Lund 2021) keinen Zugang zu den relevanten offiziellen Vertriebskanälen der deutschen Musikindustrie hatten – wie Hitparaden, Medien, Musikläden –, mussten sie ihre eigenen, unabhängigen Vertriebswege erfinden. Das gelang mit Lebensmittelgeschäften und Gemischtwarenläden als Hauptverkaufsstellen und türkischen Zeitungen zur Platzierung von Musik in Medien.[4] Was aus diesem Phänomen hervorgeht, ist in den Worten von Teresa Vena,
„dass diese wortwörtlich Millionen an in Deutschland ansässige Türken verkauften Kassetten völlig an der restlichen deutschen Bevölkerung vorbeigingen. Die Größe dieses Industriezweigs fand weder im politischen noch gesellschaftlichen Bewusstsein eine Entsprechung“ (Vena 2022).
Hazar formuliert hierzu:
„[…] meiner Meinung nach sind die Gründe für den Mangel an gegenseitiger Beeinflussung, und nicht nur im Bereich der Musik, sondern auch in anderen kulturellen Bereichen, im Prozess der Verarbeitung des Phänomens der Migration durch die Türken aber ganz besonders auch durch die Deutschen zu suchen“ (Hazar 1998: 287).
Hazar diagnostiziert nach einer 15-jährigen Abwesenheit bei der Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2017:
„[Wir] fanden […] Parallelwelten, in denen Migrant*innen und Einheimische nun lebten. Es war alles fast friedlich, aber existierte nebeneinander. Auch unter den Türkeistämmigen waren Parallelwelten entstanden. Gefühlt waren die Türken, die Kurden, die Aleviten, die Laizisten und so weiter hier noch eins, als ich 2003 nach Istanbul ging“ (Hazar 2021: 20).
Woher kommt das und woran liegt das? In ihrem Grußwort zu Hazars Buch von 2021 schreibt die SPD-Politikerin Lale Akgün:
„[…][E]s geht um verschiedene Kulturen, die [angeblich] nicht oder kaum zusammenzubringen sind. Dies nährt die Vorstellung, dass Migrant*innen auch nach sechzig Jahren immer noch in ihrer Blase leben und mit der Mehrheitskultur kaum oder wenig in Berührung kommen. Eine Vorstellung, die zugleich eine Beleidigung für die Migrant*innen und für die Mehrheitskultur ist: Die einen leben in ihrer abgeschotteten Welt und die anderen haben eine so schwache Kultur, dass diese nicht in der Lage ist, Einfluss auf Eingewanderte zu übernehmen“ (ebd.: 11f).
Akgün bemerkt allerdings auch im Vergleich mit spanischen Migrant*innen:
„[…] [V]iele Intellektuelle verließen ihr Land aufgrund des Franco-Regimes. In Deutschland haben sie sich ernsthaft um die Bildung aller spanischen Kinder gekümmert. Sie haben Elternvereine gegründet und Arbeiterfamilien auf Lehrergespräche vorbereitet. Ich weiß nicht, ob die türkische Militärjunta in den 1980er-Jahren davon wusste. Sie wussten aber, dass die nach Deutschland geflüchteten Intellektuellen nie die Meinungshoheit über die Gastarbeiter*innen bekommen sollten. Deswegen wurden hier so viele islamische Verbände gegründet – gut finanziert aus der Türkei, um eine Alternative zu bieten, die Leute zu islamisieren und dafür zu sorgen, dass sie nicht politisch aufwachen. Und es ist ihnen auch gelungen. Eine erfolgreiche Initiative“ (ebd.: 140).
Mit der hier angesprochenen Abgrenzung durch eine islamische Bildung geht eine religiös motivierte Ab- und Entwertung türkischer Musik einher, da vor allem im konservativen sunnitischen Islam Musik kaum einen Stellenwert besitzt, weil sie gewissen Koranauslegungen nach per se an Tanz, Alkohol und Erotik gekoppelt sei, also aus religiöser Sicht verwerflich sei (Tas 2014: 381). Dies leistet einer musikalischen Selbstausgrenzung Vorschub, wie im folgenden Kapitel gezeigt wird.
5. Inwiefern findet eine Entwertung türkischer Musik im Rahmen von Selbstausgrenzung statt?
Zur Selbstausgrenzung notierte Gunda Bartels unlängst:
„Bestürzend ist, dass die durch den Sänger Muhabbet oder die Rapperin Aziza A repräsentierte Postmigrantengeneration kaum mit dem eigenen künstlerischen Erbe vertraut ist. Mit Leuten wie Yüksel Özkazap, der Nachtigall von Köln, die in ihren ‚Liedern aus dem Exil‘ Heimweh und Isolation der Männer und Frauen aus der Türkei in wehmütigen Arabesken besang“ (Bartels 2022).
„Darüber wird nicht berichtet, die Überlieferung findet nicht statt“, ergänzt der Regisseur Cem Kaya (ebd.). Dieser Überlieferungsbruch kommt von drei Seiten her zustande: erstens, wie soeben beschrieben, von der Seite des sunnitischen Islams, der Musik generell ablehnt; zweitens von der repressiven, die unmittelbare musikalische Vergangenheit ablehnenden Musikpolitik der Militärjunta im Anschluss an den Putsch im Jahr 1980 (vgl. Greve 2017: 192); und drittens von vorherrschenden Verwestlichungstendenzen ab den 1990er-Jahren, die zu einer Abwertung anatolisch basierter Musik geführt haben. Yaprak Uyar, Wissenschaftlerin und Musikerin, spricht von „the particularly complex nature of Westernization in Turkish society“. Sie führt aus:
„As a DJ performing in my early 20s [um die 2000er-Jahre], I recall hiding my Balkan and Anatolian folk music knowledge inherited from my family among my peers, because those weren‘t appreciated as ‚hip‘ back in those times. Before the age of internet, performance and a taste of Anatolian folk music were attributed to working-class and rural populations in Turkey“ (Uyar 2021: 11, Anführungszeichen i. O.).
Der nicht-westliche Hybridanteil, mithin der anatolische Teil des Anadolu Pop, wirkte negativ bei dem ultimativen Verwestlichungswunsch einer damals jungen türkischen Generation, sowohl sozial als auch musikalisch. Folglich wurde er unterdrückt. Dass zudem die Wahrnehmung bestand, „that people in Germany didn‘t like Turkish music“, wie es die in Deutschland aufgewachsene Musikerin Derya Yıldırım zusammengefasst hat (Yıldırım, in Rigney 2021), konnte den Überlieferungsbruch nicht heilen, im Gegenteil. Inferiorisierung wurde Programm, wie Cem Kaya es formuliert: „Da wurde uns von den Deutschen auch immer klar vermittelt, durch Ignoranz oder Naserümpfen, dass unsere eigene Kultur nichts wert sei. So wurde uns schon als Kindern ein Minderwertigkeitskomplex eingepflanzt“ (Kaya, in Bax 2022).
6. Schlussbemerkung und Ausblick
Die von uns skizzierten Grenzziehungen und der Umgang mit türkischer Popmusik in Deutschland von den 1960er-Jahren bis heute zeigen, wie vielfältig und komplex die Phänomene der Abgrenzung, insbesondere der Selbst- und Fremdabgrenzung, nicht nur entlang der „Integrationsgrenze“ verlaufen. Unsere Beobachtungen liefern hierzu nur einen kleinen, unvollständigen Ausschnitt. Der Versuch, unsere Kernfragen nach Musik und Publikum, Musikfunktionen und Musikmarkt zu beantworten, führte zu einer Kritik musikrelevanter Aspekte deutscher Migrationspolitik. Er führte aber auch zu einer Kritik am institutionellen Umgang mit türkischer Musik in Deutschland, exemplarisch verdeutlicht anhand der Darstellung des Musikausstellungsbesuches des Museums für Islamische Kunst in Berlin. Eine aus unserer Sicht gewichtige Problematik, und das zeigt auch das Phänomen der Selbstausgrenzung sehr deutlich, ist der Mangel an Diskurs, historiografischer Überlieferung und strukturierter Zugänglichkeit zu migrantischen kulturellen Äußerungen. Es fehlt ganz grundlegend an Archiven. An dieser Stelle sei jedoch auf den – positiven, diskursbildenden – Wandel verwiesen, der mit umfassenden Ausstellungen wie „Wer wir sind. Fragen an ein Einwanderungsland“ (2023) in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn oder des in Köln geplanten umfassenden Migrationsmuseums des DOMiD (Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland) Fahrt aufnimmt.
Zugleich nimmt aus postmigrantischer, ethnienübergreifender Perspektive aktuell ein Diskurs an Fahrt auf, auf den wir zum Schluss noch kurz eingehen möchten. In Gegenargumentation zu einem öffentlichen Integrationsdiskurs, wie ihn zum Beispiel Süssmuth bemüht hat, möchten wir mit der „neuen Lust auf Desintegration“ antworten, wie sie die Journalistin Julia Lorenz im Berliner Stadtmagazin Tip Berlin anlässlich „60 Jahre Almanya“ feststellt (Lorenz 2021: 25). Sie koppelt daran die Frage: „Und wenn wir gar nicht dazugehören wollen?“ (Ebd.). Eure Heimat ist unser Alptraum heißt ein Sammelband, welcher 2019 von Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah herausgegeben wurde. Zuvor initiierte der Antisemitismusforscher Max Czollek mit seinem durch die Kulturstiftung des Bundes geförderten Festival Desintegration (2016) am Maxim-Gorki-Theater in Berlin, seiner Kongresspublikation Desintegration. Ein Kongress zeitgenössischer jüdischer Positionen (Czollek/Salzmann 2017) sowie mit seinem Buch Desintegriert Euch! (2018) einen dezidierten Desintegrationsdiskurs[5]. Wer möchte schon zu einem Deutschland gehören, das so mit Migrant*innen verfährt, wie wir es in diesem Artikel am Beispiel türkischer (Pop-)Musik dargestellt haben? Ausgangspunkt der differenzierenden und auch provokativen postmigrantischen Lust auf Desintegration ist allerdings, laut der Schriftstellerin Çiçek Bacik, eine bereits existierende Verbundenheit mit Deutschland als dem Land, dem man sich zugehörig erachtet und für das man nun auf eine neue, desintegrative und emanzipatorische Weise kämpfe (Lorenz 2021: 25), indem man sich den dominanten Praktiken der Fremdzuschreibungen durch die Dominanzgesellschaft entzieht und stattdessen in den unterschiedlichen, von Diskriminierung und Ausschlüssen betroffenen Bevölkerungsgruppen nach Gemeinsamkeiten, Überschneidungen und Allianzen sucht. Die „neue Lust auf Desintegration“ ist jedoch nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören, etwa in den neueren Produktionen der profilierten Rapperinnen Ebow, EsRap und NASHI44.[6] Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass in diesem letzten Kapitel unseres Beitrages fast ausschließlich Frauennamen auftauchen – denn dieser Widerstand ist zugleich ein (queer-)feministischer, genderkritischer. Und es ist einer über ethnische Communitys hinweg. Es ist ein Widerstand, den Melissa Kolukisagil, Leiterin des seit 2021 stattfindenden iç içe-Festivals für neue anatolische Musik in Berlin, wie folgt zusammenfasst: „Wir sind eben auch die Generation, die nicht mehr um den Platz fragt, sondern sich den einfach nimmt“ (Kolukisagil zit. n. Cam 2022: Min. 8:49-8:54).
Biographische Informationen
Cornelia Lund ist eine in Berlin lebende Kunst-, Film- und Medienwissenschaftlerin und Kuratorin. Sie arbeitet seit Jahren in Forschung und Lehre, hauptsächlich zu dokumentarischen und audiovisuellen künstlerischen Praktiken, Designtheorie sowie de- und postkolonialen Theorien. 2012–2018 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem DFG-Projekt zum deutschen Dokumentarfilm (Universität Hamburg), zuletzt co-kuratierte sie Connecting Afro Futures. Fashion x Hair x Design (Berlin 2019). Sie ist seit 2021 Research Fellow an der Hochschule für Künste Bremen. https://www.hfk-bremen.de/en/person/cornelia-lund/276. Kontakt: CLUND(a)hfk-bremen.de
Holger Lund arbeitet als Kunst-, Design- und Musikforscher sowie als Kurator und DJ. Seit 2011 ist er Professor für Mediendesign, Angewandte Kunst und Designwissenschaft an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg. Er betreibt auch das Musiklabel Global Pop First Wave, das sich der nicht-westlichen Popgeschichte zuwendet, insbesondere der türkischen Pop-Musik der 1960er- und 1970er-Jahre. Er veröffentlichte zahlreiche Publikationen, u.a. mit Cornelia
Lund, zu türkischer Popmusik. https://www.mediendesign-ravensburg.de/
umfeld/#personen. Kontakt: lund(a)dhbw-ravensburg.de
Seit 2004 betreiben sie zusammen die unabhängige und nichtkommerzielle Plattform fluctuating images e.V., die Kunst, Design und Musik gewidmet ist. Aktuelle Forschungsprojekte: „Different by Design“ und „Turkish Pop Music Images“. www.fluctuating-images.de
Anmerkungen
[1] Zu den einzelnen Lokalitäten und deren Umfang in Nordrhein-Westfalen vgl. ebd.: 232f.
[2] Alle Hörbeispiele sind am Ende des Textes in der Diskographie mit Links zu Online-Präsenzen aufgeführt.
[3] Vgl. Mirza Odabaşı, „Sounds aus der Seele – Musik zwischen Almanya und Deutschland.“ https://www.youtube.com/watch?v=3Y3eeloQZd4 (Zugriff: 15.6.2023).
[4] Zum türkischen Musikmarkt in Deutschland als parallelem und unabhängigem Musikmarkt vgl. Lund 2021 sowie Lund/Lund 2022: 16–21.
[5] Vgl. https://www.gorki.de/de/themenseite-festival-desintegration (Zugriff: 15.6.2023).
[6] Vgl. https://www.discogs.com/artist/4432095-Ebow-3 und https://www.discogs.com/artist/2318254-Esrap – insbesondere etwa Ebow/Yaghoobifarahs „Hengameh Skit“ (2019), Ebows „Giesing81“ (2022) und EsRaps „Der Tschusch ist da“ (2019), aber auch NASHI44s (2022) „Nails Lashes Bubble Tea“, „Butterfly“ (2021), sowie „Suck On My Spring Roll“ (2022).
Literatur
Aksünger, Handan (2013). „Gemeinschaftsbildung und Integration. Die Aleviten in Deutschland und den Niederlanden.“ In: Migrantenorganisationen. Engagement, Transnationalität und Integration: WISO Diskurs der Friedrich-Ebert-Stiftung. Gesprächskreis Migration und Integration. Hg. v. Friedrich Ebert Stiftung. München, S. 42–54.
Alkın, Ömer (Hg.) (2017). Deutsch-Türkische Filmkultur im Migrationskontext. Wiesbaden: Springer VS.
Anhegger, Robert (1982). „Die Deutschlanderfahrung der Türken im Spiegel ihrer Lieder.“ In: Gastarbeiterkinder aus der Türkei. Hg. v. Helmut Birkenfeld. München: C.H. Beck, S. 9–25.
Arın, Cihan/Bittner, Regina/Kömürcü, Onur Suzan/Lanz, Stephan/Yıldız, Erol/Becker, Jochen/Osten, Marion von (2005). „Migration und Stadt. Gespräch.“ In: Projekt Migration. Hg. v. Kölnischer Kunstverein. Köln: DuMont, S. 638–651.
Aydemir, Fatma/Yaghoobifarah, Hengameh (Hg.) (2019). Eure Heimat ist unser Alptraum. Berlin: Ullstein.
Bartels, Gunda (2022). „Heimatklänge aus Almanya. Liebe, Deutschmark und Tod: ein Musikdokumentarfilm auf der Berlinale.“ In: Tagesspiegel, https://www.tagesspiegel.de/kultur/liebe-deutschmark-und-tod-ein-musikdokumentarfilm-auf-der-berlinale-heimatklaenge-aus-almanya/28078738.html (Version vom 17.2.2022, Zugriff: 29.12.2023).
Bartsch, Patrick (2011). Musikpolitik im Kemalismus. Die Zeitschrift Radyo zwischen 1941 und 1949. (= Bamberger Orientstudien 2). Bamberg: University of Bamberg Press.
Bax, Daniel (2022). „Wir sind angekommen. Aber es hat 60 Jahre gedauert.“ Interview mit Cem Kaya. In: Zeit.de, https://www.zeit.de/kultur/film/2022-09/cem-kaya-liebe-d-mark-und-tod (Version vom 3.10.2022, Zugriff: 29.12.2023).
Becker, Jörg (2011). „Beantwortung der Fragen der Enquêtekommission ‚Migration und Integration in Hessen‘ zum Thema ‚Medien und Integration‘ im Hessischen Landtag am 13. Mai 2011.“ https://www.data4u-online.de/pr/J-Becker_Vortrag_Landtag_Hessen.pdf (Zugriff: 29.12.2023.)
Berberich, Frank/Sarrazin, Thilo (2009). „Klasse statt Masse. Von der Hauptstadt der Transferleistung zur Metropole der Eliten.“ In: Lettre International 86, S. 197–201.
Boran, Erol M. (2023). Die Geschichte des türkisch-deutschen Theaters und Kabaretts. Vier Jahrzehnte Migrantenbühne in der Bundesrepublik (1961-2004). Bielefeld: transcript.
BR (2010). „Deutsche Ausländerpolitik. Abwehren und begrenzen.“ In: BR 24 Migration in Bayern, https://www.br.de/nachricht/migration_bayern_auslaenderpolitik100.html (Version vom 24.3.2010, Zugriff: 29.12.2023).
Brake, Michael (2022). „‚Meine Freunde haben die Nase gerümpft‘.“ Interview mit Cem Kaya. In: Fluter., https://www.fluter.de/ask-mark-ve-oeluem-kaya-interview-berlinale (Version vom 14.2.2022, Zugriff: 29.12.2023).
Brennen, Bonnie S. (2021). Qualitative Research. Methods for Media Studies. Abingdon/New York: Routledge (3. Auflage).
Czollek, Max (2018). Desintegriert Euch!. Berlin: Hanser.
Czollek, Max/Salzmann, Sasha Marianna (2017). Desintegration. Ein Kongress zeitgenössischer jüdischer Positionen. Bielefeld, Berlin: Kerber.
Daadouch, Christophe (2018). „Si on chantait. L‘immigration en chanson.“ In: Plein droit. Politique migratoire: l‘Europe condamnée 118, https://www.gisti.org/spip.php?article6007 (Zugriff: 29.12.2023).
dpa (2015). „Merkel: ‚Deutschland ist ein Einwanderungsland‘.“ In: FAZ, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/angela-merkel-sieht-deutschland-als-einwanderungsland-13623846.html (Version vom 1.6.2015, Zugriff: 29.12.2023).
Eryılmaz, Aytaç/Jamin, Mathilde (Hg.) (1998). Fremde Heimat. Yaban, Sılan olur. Eine Geschichte der Einwanderung aus der Türkei. Türkiye‘den Alamanya‘ya Göçün Tahiri, Katalog. Essen: Ruhrlandmuseum.
Eryılmaz, Aytaç/Lissner, Cordula (Hg.) (2011). Geteilte Heimat. Paylaşılan Yurt. 50 Jahre Migration aus der Türkei, Katalog. Essen: Klartext.
Gaus, Bettina (2000). „Es gibt die Integrationsgrenze.“ Interview mit Rita Süssmuth. In: taz, https://taz.de/!1196000/ (Version vom 19.12.2000, Zugriff: 29.12.2023).
Genzken, Lisa (2021). „Ali singt vom Schwarzen Meer.“. In: Zenith, https://magazin.zenith.me/de/kultur/projekt-deutschlandlieder (Version vom 20.10.2021, Zugriff: 29.12.2023).
Greve, Martin (2003). Musik der imaginären Türkei. Musik und Musikleben im Kontext der Migration aus der Türkei in Deutschland. Stuttgart: J.B. Metzler.
Greve, Martin (2017). Makamsız. Individualization of Traditional Music on the Eve of Kemalist Turkey. Orient Institut Istanbul (= Istanbuler Texte und Studien 39). Würzburg: Ergon.
Güngör, Murat/Loh, Hannes (2019). „Kölsch Kültür. Türkische Popmusik im Exil.“ In: StadtRevue. Kultur Politik Stadtleben in Köln. Kölsch Kültür 3, S. 31–37.
Gutmair, Ulrich (2023). Wir sind die Türken von Morgen. Neue Welle, neues Deutschland. Stuttgart: Tropen.
Hauenstein, Hanno (2023). „Silvesternacht: die Böllerdebatte ist rassistisch.“ In: Berliner Zeitung, https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/silvesternacht-die-boeller-debatte-ist-rassistisch-li.303337 (Version vom 3.1.2023, Zugriff: 29.12.2023).
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn (2021). „Hits & Hymnen. Klang der Zeitgeschichte.“ Webseite zur Ausstellung, https://www.hdg.de/haus-der-geschichte/ausstellungen/hits-hymnen-klang-der-zeitgeschichte und das damit verbundene Ausstellungsvideo „Musik gegen Alltagsrassismus: Deutscher Hip-Hop in den 1990ern.“ https://www.you
tube.com/watch?v=vPSteZ1YI_E&list=PLSOj7M9jqAbI0m5UR7gcuOhE16peKWeeW&index=2 (Zugriff: 29.12.2023).
Hazar, Nedim (1998). „Die Saiten der Saz in Deutschland.“ In: Fremde Heimat. Yaban, Sılan olur. Eine Geschichte der Einwanderung aus der Türkei. Türkiye‘den Alamanya‘ya Göçün Tahiri. Katalog. Hg. v. Aytaç Eryılmaz und Mathilde Jamin. Essen: Ruhrlandmuseum, S. 285–297.
Hazar, Nedim (2021). Deutschlandlieder. Almanya Türküleri. Zur Kultur der türkeistämmigen Community seit dem Anwerbeabkommen 1961. Berlin: Rotbuch.
İlgiç, Sedef/Pilcz, Nazlı Sağdıç (2021). „Case File I Feature I: In the Words of Contemporary Folk Bards, the Predicament of Germany‘s ‚Guest Workers‘.“ In: #60JahreMusik. Hg. v. Yunus Emre Enstitüsü. Köln, https://www.istanbulberlin.com/en-de/dosya1_yazi1_60yilmuzik/ (Version vom 12.8.2021, Zugriff: 29.12.2023).
Jäger, Siegfried (2012). Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. Münster: Unrast (6. Auflage).
Janelli, Angela/Hammacher, Thomas (2008). Themenheft Ausstellungsanalyse. VOKUS 18 (1), https://www.kulturwissenschaften.uni-hamburg.de/ekw/forschung/publikationen/vokus/vokus200801.html (Zugriff: 29.12.2023).
Kaube, Jürgen/Kieserling, André (2022). Die gespaltene Gesellschaft. Berlin: Rowohlt.
Kendler, Benedikt (2023), „Der Rapper PTK über Kreuzberger Parallelgesellschaften, politischen Aktivismus und die Folgen der Gentrifizierung“. In: Tip Berlin 4, S. 114.
Kodýdková, Daniela (2018). Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD. Bachelorarbeit (Bc.), Fakultät für Sozialwissenschaften, Institut für internationale Studien, Lehrstuhl für deutsche und österreichische Studien. Prag: Karls-Universität.
Kölnischer Kunstverein (Hg.) (2005). Projekt Migration. Köln: DuMont.
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Hg.) (2023). Wer wir sind. Fragen an ein Einwanderungsland. Ausstellungskatalog. Bonn.
Lorenz, Julia (2021). „60 Jahre Almanya.“ In: Tip Berlin 22, S. 22–25.
Lund, Cornelia/Lund, Holger (2022). „A history of flops and a new turn. The Turkish-German music interplay.“ In: Transposition. Musique et sciences sociales, journal n°10: Flops in Music. Hg. v. Sarah Benhaïm und Lambert Dousson, https://doi.org/10.4000/transposition.7038 (Zugriff: 29.12.2023).
Lund, Holger (2020). „Decolonizing Turkish Pop Music Historiography. Anatolian Rock Studies as an Example.“ Konferenzbeitrag für „Sound/Music/Decoloniality: A Research Colloquium,“ 24.-25. März 2020, Maynooth University Arts and Humanities Institute in Zusammenarbeit mit dem Department of Music und der Society for Musicology in Ireland, https://www.researchgate.net/publication/340607051_Decolonizing_Turkish_Pop_Music_Historiography_Anatolian_Rock_Studies_as_an_Example (Zugriff: 29.12.2023).
Lund, Holger (2021). „The hidden history of Turkish independent labels in Germany from the 1960s to the 1980s.“ Konferenzbeitrag für das „Colloquium Independents, Independent Music Labels: Histories, Practices and Values.“ Lissabon, NOVA FCSH, 22.-25.6.2021, https://www.researchgate.net/publication/354451392_The_hidden_history_of_Turkish_independent_labels_in_Germany_from_the_1960s_to_the_1980s (Zugriff: 29.12.2023).
Märkisches Museum Berlin (2018). „Bizim Berlin 89/90. Fotografien von Ergun Çağatay.“ Webseite zur Ausstellung, https://www.stadtmuseum.de/ausstellung/bizim-berlin-89-90 (Zugriff: 29.12.2023).
Matteoni, Federica (2023). „Laschet gegen AFD: ‚Ihre Gesinnungsgenossen haben Menschen ermordet‘.“ In: Berliner Zeitung, https://www.berliner-zeitung.de/news/rede-im-bundestag-armin-laschet-cdu-gegen-afd-ihre-gesinnungsgenossen-haben-menschen-ermordet-li.367210 (Version vom 7.7.2023, Zugriff: 29.12.2023).
Mattern, Jens (2023). „Langhaardackel mit Stromgitarren: Kulturkampf einst im Schwarzwald.“ In: Telepolis, https://www.telepolis.de/features/Langhaardackel-mit-Stromgitarren-Kulturkampf-einst-im-Schwarzwald-7527838.html?wt_mc=nl.red.telepolis.telepolis-nl.2023-03-03.link.link (Version vom 26.2.2023, Zugriff: 29.12.2023).
Mbembe, Achille (2015). Critique de la raison nègre. Paris: Édition La Découverte.
Mucuk, Gonca (2011). „DiskoMisko à la Turca.“ In: Geteilte Heimat. Paylaşılan Yurt. 50 Jahre Migration aus der Türkei. Hg. v. Aytaç Eryılmaz und Cordula Lissner. Köln. S. 232–234.
Museum Store Association (2015). Museum Store: the Manager‘s Guide. Basic Guidelines for the New Museum Store Manager. London, New York: Routledge (4. Auflage).
Neubauer, Jochen (2011). Türkische Deutsche, Kanakster und Deutschländer. Identität und Fremdwahrnehmung in Film und Literatur: Fatih Akin, Thomas Arslan, Emine Sevgi Özdamar, Zafer Şenocak und Feridun Zaimoğlu. Würzburg: Königshausen u. Neumann.
Ramm, Christoph (2020). „Turkey‘s ‚Light‘ Rock Revolution. Anadolu Pop, Political Music and the Quest for the Authentic.“ In: Turkey in Turmoil. Social Change and Political Radicalization During the 1960s. Hg. v. Berna Pekesen. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, S. 256–278.
Rat für Migration (Hg.) (2014). Dossier Mythen und Wahrheiten. Sarrazins Thesen im Faktencheck. Berlin: Mediendienst Integration, https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Sarrazins_Thesen_Dossier.pdf (Zugriff: 29.12.2023).
Reier, Sebastian (2020). „Türkei: Die Musik von Nebenan.“ In: Zeit, https://www.zeit.de/2020/06/tuerkei-popmusik-baris-manco-metin-tuerkoez-derdiyoklar (Version vom 29.1.2020, Zugriff: 29.12.2023).
Rigney, Robert (2021). „Derya Yıldırım.“ In: Berlin Bazzar, https://web.archive.org/web/20210731192728/https://berlinbazzar.com/derya-yildirim/ (Version vom 26.2.2021, Zugriff: 29.12.2023).
Ruhland, Tobias/Wilczek, Alba (2022). „Songs of Gastarbeiter.“ In: Zündfunk, https://web.archive.org/web/20220120194036/https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zuendfunk/songs-of-gastarbeiter-volume-zwei-imran-ayata100.html (Version vom 12.1.2022, Zugriff: 29.12.2023).
Siouti, Irini/Spies, Tina/Tuider, Elisabeth/Unger, Hella von/Yildiz, Erol (Hg.) (2022). Othering in der postmigrantischen Gesellschaft. Bielefeld: transcript.
Specht, Frank (2022). „Zuwanderung erleichtern?.“ In: Handelsblatt, 2.-4.9.2022, S. 8.
Spiegel (1973). „Die Türken kommen – rette sich, wer kann.“ In: Der Spiegel 31, https://www.spiegel.de/politik/die-tuerken-kommen-rette-sich-wer-kann-a-5b1ba6e5-0002-0001-0000-000041955159 (Version vom 29.7.1973, Zugriff: 29.12.2023).
Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz (2021). „Gurbet Şarkıları. Lieder aus der Fremde. Musik und Zugehörigkeit zwischen der Türkei und Deutschland (1961–2021).“ Webseite zur Ausstellung, https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/gurbet-sarkilari-lieder-aus-der-fremde/ und https://islamic-art.smb.museum/stories/gurbet_lieder (Zugriff: 29.12.2023).
Statistisches Bundesamt (2022). „Pressemitteilung Nr. 162 vom 12.4.2022.“ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/04/PD22_162_125.html (Zugriff: 29.12.2023).
Tas, Hakki (2014). „Melodies of resistance. Islamist music in secular Turkey.“ In: Social Compass 61 (3), S. 368–383, DOI: 10.1177/0037768614535705 (Zugriff: 29.12.2023).
Uebele, Andreas (2006). Orientierungssysteme und Signaletik. Ein Planungshandbuch für Architekten, Produktgestalter und Kommunikationsdesigner. Mainz: Hermann Schmidt.
Uyar, Yaprak Melike (2021). „Turkish Disco. The Intersection of Anatolian Pop, Groove, and Psychedelia.“ In: Musicologist. International Journal of Music Studies 5 (2), S.107–132, DOI: 10.33906/musicologist.882808 (Zugriff: 29.12.2023).
Vena, Teresa (2022). „Liebe, D-Mark und Tod (2022).“ In: www.kino-zeit.de, https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/liebe-d-mark-und-tod-2022 (Version vom 19.2.2022, Zugriff: 29.12.2023).
Wissenschaftsrat (2020a). „Evaluierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Wissenschaftsrat empfiehlt grundlegende Neuordnung.“ Pressemitteilung 17/2020, Berlin, https://www.wissenschaftsrat.de/download/2020/pm_1720.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Version vom 13.7.2020, Zugriff: 29.12.2023).
Wissenschaftsrat (2020b). Strukturempfehlungen zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), Berlin. Drs. 852 0-20, Berlin, https://www.wissenschaftsrat.de/download/2020/8520-20.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (Version vom 10.7.2020, Zugriff: 29.12.2023).
Wurm, Maria (2006). Musik in der Migration. Beobachtungen zur kulturellen Artikulation türkischer Jugendlicher in Deutschland. Bielefeld: transcript Verlag.
Diskographie
Ebow/ Hengameh Yaghoobifarah (2019). „Hengameh Skit.“ Auf: K4L. Problembär Records PB O85 LP, https://www.youtube.com/watch?v=veg_pwDZx28 (Zugriff: 29.12.2023).
Ebow (2022). „Giesing81.“ Auf: Canê. Virgin Music ALV004, https://www.youtube.com/watch?v=gT_cG3iw_A0 (Zugriff: 29.12.2023).
EsRap (2019). „Der Tschusch ist da.“ Auf: Tschuschistan. Springstoff CD-ERTD-0136, https://www.youtube.com/watch?v=ogjhowdiZPk (Zugriff: 29.12.2023).
Mazhar ve Fuat (1973). „Nerde Hani.“ Auf: Türküz Türkü Çağırırız! Yonca YCLPAS-5006, https://www.youtube.com/watch?v=cq0pmFzVEUc (Zugriff: 29.12.2023).
Metin Türköz (o.D., verm. 1970er-Jahre). „Meister İşçi Kavgası.“ Türkofon 8666, https://www.youtube.com/watch?v=JyRPQROTQ3I (Zugriff: 29.12.2023).
NASHI44 (2021). „Butterfly.“ Auf: Asia Box. No Label, https://www.youtube.com/watch?v=fxqVxC5BtdY (Zugriff: 29.12.2023).
NASHI44 (2022). „Nails Lashes Bubble Tea.“ Auf: Asia Box. No Label, https://www.youtube.com/watch?v=JYOIQJGN9Nc (Zugriff: 29.12.2023).
NASHI44 (2022) „Suck On My Spring Roll.“ Auf: Asia Box. No Label, https://www.youtube.com/watch?v=mS3RN3OmGHk (Zugriff: 29.12.2023).
Audiovisuelle Medien
Ayata, İmran/Kullukcu, Bülent (2022), „Wild Wild Germany.“ In: Songs of Gastarbeiter, https://www.songs-of-gastarbeiter.com/vol-ii (Zugriff: 29.12.2023).
Cam, Ufuk (2022). „We‘re good – anatolische Musik für Alle.“ In: RBB Kultur, vom 7.6.2022, Min. 8:49-8:54, https://www.youtube.com/watch?v=E3ZCTAIK8vQ (Zugriff: 29.12.2023).
Graves, Barry (1982). In: Möller, Sirkka (2022), „Berlinale Meets“ (Interview mit Cem Kaya zu seinem Film Aşk, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod), vom 4.2.2022, Einspieler mit Barry Graves Min. 1:47-02.51, https://www.youtube.com/watch?v=GdgJFEdIUcU (Zugriff: 29.12.2023).
Vollmer, Manfred (1998). „Diskothek in Gelsenkirchen, 1974.“ Fotografie. In: Fremde Heimat. Yaban, Sılan olur. Eine Geschichte der Einwanderung aus der Türkei. Türkiye‘den Alamanya‘ya Göçün Tahiri. Katalog. Hg. v. Aytaç Eryılmaz und Mathilde Jamin. Essen: Ruhrlandmuseum, S. 311.
Zitiervorschlag
Lund, Cornelia/Lund, Holger (2024). „Grenzziehungen – zum Umgang mit türkischer Popmusik in Deutschland von den 1960er-Jahren bis heute.“ In: „Parallelgesellschaften“ in populärer Musik? Abgrenzungen – Annäherungen – Perspektiven. Hg. v. Ralf von Appen, Sarah Chaker, Michael Huber und Sean Prieske. GFPM – Beiträge zur Popularmusikforschung 48 meets ~Vibes – The IASPM D-A-CH Series Vol. 3. Bielefeld: transcript, S. 89-116 und online: http://vibes-theseries.org/grenzziehungen-zum-umgang-mit-turkischer-popmusik-in-deutschland-von-den-1960er-jahren-bis-heute/ [26.9.2024].
Cover Picture: Cassettencover Mustafa Kuş Grup İmece – Karadut, Inlay Fold-out,
© Burak, Istanbul, 1985.